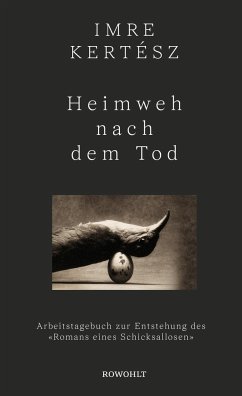Dreißigjährig, nach Jahren erfolgloser Arbeit an seinem ersten Romanprojekt «Ich, der Henker», den Bekenntnissen eines Naziverbrechers, entschließt Imre Kertész sich zu einer «nüchternen Selbstprüfung». Daraus erwächst zwischen 1958 und 1962 sein erstes Tagebuch - 44 eng beschriebene Blätter. Und während er noch mit Musik-Komödien für die Budapester Bühnen seinen Lebensunterhalt verdient, hält er hier minutiös sein Denken, Lesen und Schreiben fest: vom Entschluss, statt der Henker-Bekenntnisse nun die Geschichte seiner Deportation zu schreiben - also «meine eigene Mythologie» -, bis hin zur Fertigstellung der ersten Kapitel. Dazu die unablässige Auseinandersetzung mit Dostojewski, Thomas Mann und Camus, mit deren Hilfe er die für diesen beispiellosen Entwicklungsroman benötigte Technik findet.
«Der Muselmann», so sollte der «Roman eines Schicksallosen» ursprünglich heißen. Zehn weitere Jahre würde Kertész noch zu seiner Vollendung brauchen, um anschließend zu erleben, wie das Buch, das dreißig Jahre später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden würde, im sozialistischen Ungarn zunächst abgelehnt wurde.
Vom Zustand des «Muselmanns», jener «zerstörend süßen Selbstaufgabe», die Imre Kertész in Buchenwald kurz vor der Befreiung selbst kennengelernt hatte, erzählen die eindrücklichsten Seiten dieses Arbeitstagebuchs: «Der Mensch kann nie so nahe bei sich selbst und bei Gott sein wie der Muselmann unmittelbar vor dem Tod.»
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
«Der Muselmann», so sollte der «Roman eines Schicksallosen» ursprünglich heißen. Zehn weitere Jahre würde Kertész noch zu seiner Vollendung brauchen, um anschließend zu erleben, wie das Buch, das dreißig Jahre später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden würde, im sozialistischen Ungarn zunächst abgelehnt wurde.
Vom Zustand des «Muselmanns», jener «zerstörend süßen Selbstaufgabe», die Imre Kertész in Buchenwald kurz vor der Befreiung selbst kennengelernt hatte, erzählen die eindrücklichsten Seiten dieses Arbeitstagebuchs: «Der Mensch kann nie so nahe bei sich selbst und bei Gott sein wie der Muselmann unmittelbar vor dem Tod.»
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Dass Imre Kertészs "Roman eines Schicksallosen" von 1975 eines der bedeutsamsten Werke über den Holocaust ist, steht für Rezensentin Iris Radisch außer Frage - hochinteressiert verfolgt sie daher die nun veröffentlichten Tagebucheinträge, die die Entstehungszeit dieses Romans zwischen 1958 und 1962 dokumentieren. Vor allem verdeutlichen sie, so Radisch, wie Kertész, der sich zuvor mit "seichten Komödien" über Wasser gehalten habe, jahrelang um den richtigen Tonfall rang, um von seiner Zeit im KZ zu erzählen. Inspiration schenkten ihm schließlich der Ton des "kindlichen Gleichmuts" in Camus' Der Fremde und die "süße Selbstaufgabe", eben das titelgebende "Heimweh nach dem Tod", die die Personen in Thomas Manns Zauberberg auszeichnen, lernt Radisch. Interessant und erschütternd findet die Kritikerin auch das Manifest über den "funktionalen Menschen" am Ende des Bands, in dem sie eine "noch unbekannte Zuspitzung" von Kertész Lesart des modernen Menschen als reines Funktions- und Fiktionsprodukt findet. Von der Bitterkeit, die sich in seinem späten Tagebuch finden, ist hier nichts zu spüren, erkennt die bewundernde Rezensentin, nur "illusionslose Klarheit".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Rezensentin Julia Hubernagel erkennt im Arbeitstagebuch der Jahre 1958-1962 von Imre Kertesz, wie genau der Autor seinen großen Lagerroman schon früh konzipierte, wie er ihn mit Wahlverwandten wie Camus und Schopenhauer abglich und überhaupt zur Einsicht gelangte, dass das Schreiben über das Erlebte und Erlittene notwendig sei. Auch über die Zufälligkeit von Opfer- und Täterrolle denkt der Autor hier nach, erklärt Hubernagel, und er klagt über die Lohnschreiberei, die ihn von Wichtigerem abhalte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Die vergilbten Blätter sind ein Dokument, wie es sonst in der Literatur kaum vorkommt. ....Was diese frühen Tagebücher aus der Werkstatt von Kertész so besonders macht, ist die darin verhandelte prekäre Verwicklung von Sprache und Erfahrung. Paul Jandl Neue Zürcher Zeitung 20220513