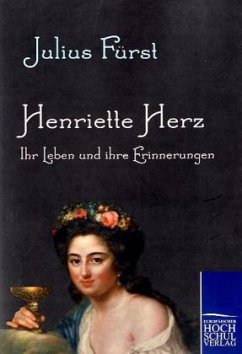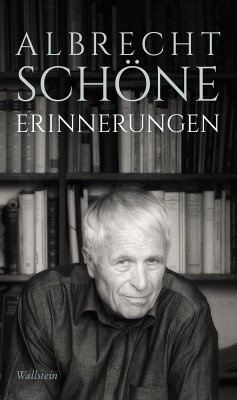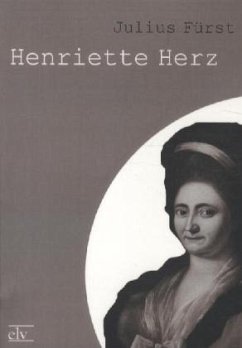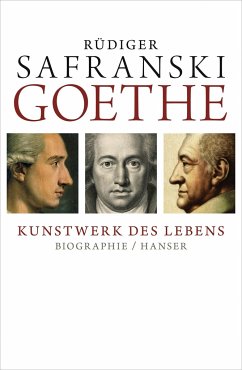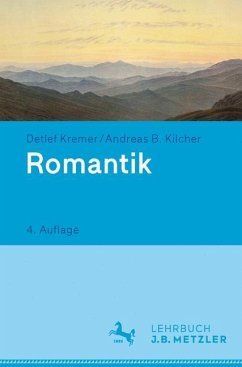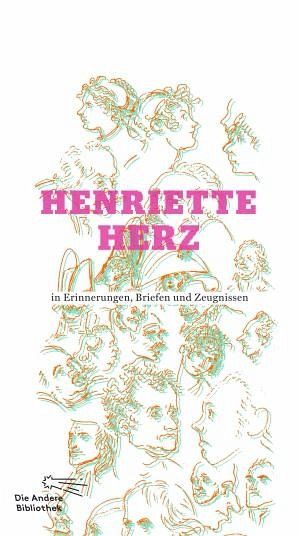
Henriette Herz in Erinnerungen, Briefen und Zeugnissen
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
40,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Wer den Gens'darmenmarkt und Mad. Herz nicht gesehen hat, hat Berlin nicht gesehen.« Nichts spiegelt die gesellschaftliche Position der schönen wie geistvollen Frau besser wider: mit ihrem literarischen Salon war Henriette Herz jahrzehntelang Mittelpunkt des kulturellen Lebens in der preußischen Metropole. Die Herren verehrten sie wegen ihrer Schönheit, erlagen aber genauso wie die Damen ihrer geistigen Reize: Schleiermacher, Madame de Stael, Jean Paul, Börne, die Humboldts und viele andere Gelehrte, Politiker und Künstler genossen ihre Gastfreundschaft. Die Aufzeichnungen der aufgekl�...
»Wer den Gens'darmenmarkt und Mad. Herz nicht gesehen hat, hat Berlin nicht gesehen.« Nichts spiegelt die gesellschaftliche Position der schönen wie geistvollen Frau besser wider: mit ihrem literarischen Salon war Henriette Herz jahrzehntelang Mittelpunkt des kulturellen Lebens in der preußischen Metropole. Die Herren verehrten sie wegen ihrer Schönheit, erlagen aber genauso wie die Damen ihrer geistigen Reize: Schleiermacher, Madame de Stael, Jean Paul, Börne, die Humboldts und viele andere Gelehrte, Politiker und Künstler genossen ihre Gastfreundschaft. Die Aufzeichnungen der aufgeklärten, kritisch und humanistisch eingestellten Frau jüdischer Herkunft, 1818 in Rom begonnen und erstmals 1850 erschienen, bieten eine einzigartige und einzige Quelle der frühen Berliner Romantik. Den äußeren Rahmen ihres Lebens bildet das bewegte, ausklingende 18. Jahrhundert: Berlin auf dem Weg zur Königsstadt von Weltrang, die Französische Revolution, die Befreiungskriege, die Julirevolution,der Übergang der feudalen in die bürgerliche Welt. Briefe jener Jahre ergänzen das Lebensbild einer gebildeten und hoch intelligenten Frau, die »mit allen vorzüglichen Menschen Berlins in geselligem Verkehr« (Henriette Herz) stand: allen voran Friedrich Schleiermacher, mit dem sie eine langjährige Freundschaft verband, Dorothea von Schlegel, Ludwig Börne, August Wilhelm Schlegel und nicht zuletzt Goethe. Und wir begegnen alten »Bekannten« der AB: Chamisso, Humboldt, Jean Paul und Karl Philipp Moritz.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.