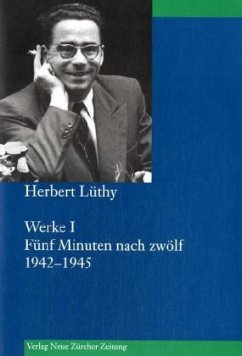Der Eröffnungsband der Werkausgabe enthält sämtliche von Lüthy verfassten Texte der «Kleinen Wochenschau» aus dem «St. Galler Tagblatt» in den Jahren 1942-1944, gefolgt von vier thematisch verwandten Essays. Die Berichte des jungen Autors über den Zweiten Weltkrieg überzeugen noch heute durch Klarsicht, Engagement und brillanten Stil. Werkausgabe gesamt:Werke I «Fünf Minuten nach zwölf, 1942-1945»Werke II «Frankreichs Uhren gehen anders» Werke III «Essays I, 1940-1964»Werke IV «Essays II, 1963-1990»Werke V «Essays III (Frankreich), 1941-1990»Werke VI & VII «La Banque Protestante en France de la Révocation de l'Edit de Nantes à la Révolution I & II»

Der schweizerische Historiker als unbestechlicher Beobachter: Zeugnisse seiner frühen Schaffensperiode / Von Paul Stauffer
Daß Historikern die Ehre einer Werkausgabe zuteil wird, ist eher selten. Zu den solcherart Ausgezeichneten gehört seit kurzem der Schweizer Herbert Lüthy. Das Erscheinen der ersten zwei einer auf sieben Bände angelegten Edition seiner Schriften durfte er noch erleben. Mitte November 2002 ist er im 85. Altersjahr in Basel gestorben. Lüthy war ein unorthodoxer Vertreter seines Faches, und als solchen weisen ihn schon die wiederveröffentlichten Zeugnisse seiner frühen Schaffensperiode aus. Des öftern wurde ihm eine Doppelbegabung attestiert: einerseits der "zünftige" Historiker, der insbesondere zur Erforschung der Wirtschafts- und Religionsgeschichte des französischen Ancien régime einen maßstabsetzenden Beitrag leistete; andererseits der Publizist, der sich mit klarsichtigen, glänzend formulierten Stellungnahmen in die Diskussion über Themen der politischen und literarischen Aktualität einschaltete.
Man wird Lüthys bekanntestes Buch, die 1954 erstmals erschienene Monographie "Frankreichs Uhren gehen anders", zunächst zwar dem Konto des Publizisten gutschreiben, bei der Lektüre aber sehr bald feststellen, daß das Werk seine Faszinationskraft wesentlich dem staunenswerten Fundus historischer Kenntnisse und Einsichten verdankt. Das Buch ist nur vordergründig eine Momentaufnahme des Frankreich jener Vierten Republik, die 1958 durch de Gaulles Machtübernahme ihr ruhmloses Ende finden sollte. Lüthy nimmt Gegenwartsphänomene verschiedenster Art - politische, gesellschaftliche, mentalitätsmäßige und nicht zuletzt wirtschaftliche - in geschichtlicher Perspektive wahr und führt sie auf Konstanten französischer Wesensart zurück. Instruktiv ist etwa sein Nachweis ungebrochener Kontinuität in dem von ihm als zentrales Element französischer spécificité erkannten Bereich der Staatsverwaltung: Traditionslinien lassen sich von der Beamtenelite des 19. und 20. Jahrhunderts, hervorgegangen aus den prestigeträchtigen Grandes Ecoles, über die Grands Commis des absolutistischen Zeitalters bis zu den Legisten im Dienste des mittelalterlichen Königtums zurückverfolgen.
Lüthys Sensorium für die Existenz eines "Frankreich, das dauert", verführt ihn indes keineswegs zu unkritischer Frankophilie. Er mokiert sich über die pseudoreligiöse Verehrung eines "ewigen Frankreich, dem seine Dichter und allzuoft auch seine Vereinsredner ihre Mysterienkulte weihen". Sehr wohl aber glaubt der kühle Ironiker an eine "Persönlichkeit Frankreichs . . ., die sich mit aller Kraft und List an ihre Gewohnheiten und auch an ihre Unarten klammert". Wie widerborstig sich diese "Persönlichkeit" gebärden kann, haben "Reformer und Organisatoren von innen und außen, Nachbarn und Vertragskontrahenten . . . immer wieder und oft mit Ungeduld erfahren". Ob Frankreichs Rolle im europäischen Integrationsprozeß Lüthy zu Retuschen an diesem Befund veranlaßt hätte, wenn er in späteren Jahren auf das Thema seines Buches zurückgekommen wäre? Man darf es bezweifeln. Er glaubte, den "tiefsten Wesenszug der französischen Geschichte" darin erkannt zu haben, "daß diese Nation im Grunde immer nur mit sich selber beschäftigt war, auch dann und gerade dann, wenn sie sich in ihren größten Augenblicken mit der Christenheit, dem Abendland oder der Menschheit schlechthin identifizierte. Frankreich hat die Welt immer nur als Projektion seiner selbst gekannt und verstanden."
Es trägt nicht wenig zum Reiz von Lüthys Frankreich-Buch bei, daß der Autor, der solcher Erkenntnisse sub specie aeternitatis fähig ist, auch als kundiger Deuter eher ephemerer Erscheinungen - etwa auf der Pariser Polit- und Literaturszene - zu überzeugen und zu unterhalten weiß. Seine ironisch gestimmte Demontage Jean-Paul Sartres bleibt ein Paradestück geistreicher Polemik. Angesichts des Kultstatus des "Denkmeisters" der damaligen französischen linken Intelligenzija war sie 1954 auch ein Akt nonkonformistischer Zivilcourage. Lüthy war nicht der Mann, sich mit solchem Ausscheren aus dem Meinungskonsens des politisch-literarischen Zeitgeistes profilieren zu wollen. Er war intellektuell einfach zu redlich und - vor allem sich selbst gegenüber - zu anspruchsvoll, um in der jeweils vorherrschenden Modeströmung unkritisch mitschwimmen zu können.
Aber nicht erst der Autor von "Frankreichs Uhren gehen anders" erweist sich als gegen ideologische Umwelteinflüsse jeglicher Provenienz immun. Dem Erscheinen seines Bestsellers um rund ein Jahrzehnt vorausgegangen war die Veröffentlichung zweiter Sammelbände mit außenpolitischen Wochenkommentaren, die Lüthy zwischen September 1942 und Jahresende 1944 in einer Ostschweizer Regionalzeitung publiziert hatte. Sie wurden für die Werkausgaben in einem Band unter dem (ein Hitler-Diktum ironisierenden) Titel "Fünf Minuten nach zwölf" zusammengefaßt.
Schon an diesen Texten des damals 25 Jahre alten und eben promovierten Historikers verblüfft eine außergewöhnliche Eigenständigkeit des Urteils, nebst der für Lüthys Prosa fortan kennzeichnenden Gabe schlagender Formulierung. Sein Augenmerk gilt vorab der politischen Dimension des Kriegsgeschehens; zum Chronisten der militärischen Operationen im engeren Sinne fühlte er sich eingestandenermaßen nicht berufen. Mit dem Zensurregime, dem die Schweizer Presse während des Krieges unterstellt war, scheint Lüthy nie ernsthaft in Konflikt geraten zu sein. Aber er gibt an, sich eingedenk dieser Überwachung eine gewisse präventive Selbstzensur auferlegt zu haben. Gleichwohl wirken seine Äußerungen bemerkenswert freimütig, wie denn die Zensurpraxis im neutralen, vom mächtigen Nachbarn pressepolitisch immer wieder unter Druck gesetzten Kleinstaat keine wirklich repressive war.
Die Willkür einer härteren Zensur, freilich von ganz anderer Seite, sollte Lüthy erst nach Kriegsende zu spüren bekommen. Die amerikanischen Besatzungsbehörden in Deutschland untersagten die Verbreitung seiner Kriegskommentare. Urheber dieser Weisung soll der zum amerikanischen Presseoffizier "mutierte" einstige Wiener Journalist Hans Habe gewesen sein. Vermutlich ist Lüthy hier das Opfer seiner geistigen Unabhängigkeit und intellektuellen Integrität geworden. Zwar hatten aus den Reihen der europäischen Neutralen nur wenige den publizistischen Kampf gegen das nationalsozialistische Regime und seine Propaganda so luzide geführt wie gerade er. Auch dem brisanten, während des Krieges weithin tabuisierten Thema der nationalsozialistischen Judenverfolgung und -vernichtung war er nicht ausgewichen. Gleich zu Beginn seiner Pressearbeit, im September 1942, hatte er dem Protest französischer Bischöfe gegen die "Judentreibjagd" in ihrem Land Beifall gezollt. Wenig später wies er erneut auf die "Verfolgung und Verschleppung" der Juden und die "Austilgung des Judentums" in Hitlers europäischem Machtbereich hin. Anfang Juli 1944 empörte er sich explizit über die Vergasung Hunderttausender ungarischer Juden in den "polnischen Vernichtungslagern".
Ein unbestechlicher Beobachter wie Lüthy nahm aber auch an Entgleisungen von Exponenten der Gegenseite - bis hin zur Kultfigur Winston Churchill - Anstoß, etwa an dessen "kaltschnäuziger Art", die "Austreibung von fünf Millionen Deutschen" aus den neu Polen zugeschlagenen Territorien "als natürlichste Lösung und sicherste Friedensgarantie" hinzustellen. Den Bannstrahl des amerikanischen Zensors mag Lüthy sich indes dadurch zugezogen haben, daß er den Plan des amerikanischen Finanzminister Morgenthau zur De-Industrialisierung Deutschlands als "baren Irrsinn" abqualifizierte und die These von der deutschen Kollektivschuld als Rückfall in barbarisches Rechtsdenken verurteilte.
Herbert Lüthy: Gesammelte Werke. Herausgegeben von Irene Riesen und Urs Bitterli. Band I: Fünf Minuten nach zwölf. 1942 - 1945. Band II: Frankreichs Uhren gehen anders. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2002. 580 Seiten und 420 Seiten, 60,- [Euro] und 44,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Mit großer Begeisterung hat Rezensent Paul Stauffer die ersten beiden einer auf sieben Bände angelegten Werkausgabe der Schriften des schweizerischen Historikers Herbert Lüthy gelesen. Stauffer würdigt Lüthy als "unbestechlichen Beobachter" und "unorthodoxen Vertreter seines Faches", der sowohl als "zünftiger Historiker" Maßstäbe setzte als auch als Publizist mit "klarsichtigen, glänzend formulierten Stellungnahmen" hervortrat. Seine erstmals 1954 erschienene Monografie "Frankreichs Uhren gehen anders" (Band II) sei nur vordergründig eine Momentaufnahme der Vierten Republik. Lüthy nehme darin Gegenwartsphänomene verschiedenster Art - politische, gesellschaftliche, mentalitätsgeschichtliche, wirtschaftliche - in geschichtlicher Perspektive wahr und führe sie auf Konstanten französischer Wesensart zurück. Besonders angetan zeigt sich Stauffer hierbei von Lüthys Fähigkeit, sowohl Erkenntnisse sub specie aeternitate vorzulegen, als auch ephemere Erscheinungen etwa der Pariser Polit- und Literaturszene kundig zu deuten. Als "Paradestück geistreicher Polemik" lobt Stauffer in diesem Zusammenhang Lüthys "ironisch gestimmte Demontage" Jean-Paul Sartres. Auch das aus Lüthys früher Schaffensperiode stammende Werk "Fünf Minuten nach zwölf", das sich der politischen Dimension des Kriegsgeschehens widmet, hat Stauffer rundum überzeugt. "Verblüffend" findet er schon hier die "außergewöhnliche Eigenständigkeit des Urteils" und die Gabe zu "schlagenden Formulierungen" des gerade promovierten 25-jährigen Lüthy.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"