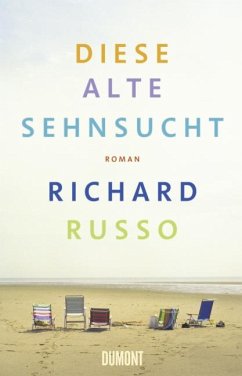Nicht lieferbar
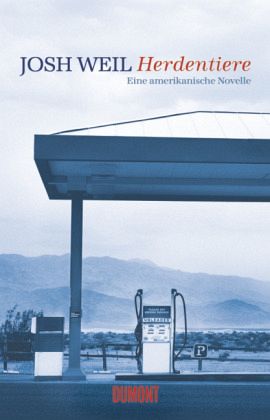
Herdentiere
Eine amerikanische Novelle. Ausgezeichnet mit dem 5 Under 35 Fiction Award 2009
Übersetzung: Kleiner, Stephan
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Osby Caudill lebt in einer Gegend, in der er mehr Kühe als Menschen zu sehen bekommt: in den Blue Ridge Mountains in Virginia. Gemeinsam mit seinem Vater kümmert er sich seit Jahrzehnten um die Angus- und Hereford-Herden. Es ist ein raues, wortkarges Leben, das Josh Weil in 'Herdentiere' mit seiner kraftvollen, beeindruckend suggestiven Sprache beschwört. Ein Leben, das Osby vermutlich niemals infrage gestellt hätte, wenn sich sein Vater nicht eines Nachmittags eine Kugel in den Kopf geschossen hätte. Josh Weil beschreibt die Suche seines Helden nach einem Platz in der Welt mit Sanftheit,...
Osby Caudill lebt in einer Gegend, in der er mehr Kühe als Menschen zu sehen bekommt: in den Blue Ridge Mountains in Virginia. Gemeinsam mit seinem Vater kümmert er sich seit Jahrzehnten um die Angus- und Hereford-Herden. Es ist ein raues, wortkarges Leben, das Josh Weil in 'Herdentiere' mit seiner kraftvollen, beeindruckend suggestiven Sprache beschwört. Ein Leben, das Osby vermutlich niemals infrage gestellt hätte, wenn sich sein Vater nicht eines Nachmittags eine Kugel in den Kopf geschossen hätte. Josh Weil beschreibt die Suche seines Helden nach einem Platz in der Welt mit Sanftheit, Genauigkeit und Lakonie.