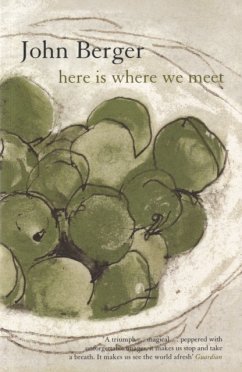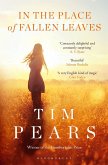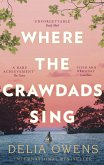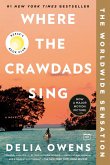John Berger stellt sich zum Achtzigsten unheimlichen Begegnungen
Vielleicht, so vermutet John Berger im ersten Kapitel seines neuen Buches, zeigen sich die Toten in Lissabon eher als anderswo; vielleicht, so der Erzähler von "Hier, wo wir uns begegnen", der an einem heißen Tag im Mai in Lissabon auf seine vor fünfzehn Jahren verstorbene Mutter trifft, mache die unvergeßliche Musik des Fado die portugiesische Hauptstadt zu einem besonderen "Haltepunkt für Tote". Die alte Frau sitzt unter ihrem aufgespannten Schirm auf einer Bank, und es gehört zu den charakteristischen Eigenschaften von Bergers Sensibilität, daß er - Augenblicke, bevor er sie schließlich erkennt - zuerst noch die Stille wahrnimmt, die seine Mutter umgibt.
Bergers Aufmerksamkeit richtet sich seit jeher nicht allein auf das Sichtbare, sondern auch auf dessen Aura, auf das Unsichtbare neben den Dingen, das doch untrennbar mit ihnen verbunden ist und sich nur dem inneren Auge zeigt. In "Hier, wo wir uns begegnen", seinem faszinierenden, die eigene Biographie umspielenden Erinnerungsbuch, läßt Berger Vergangenheit und Gegenwart zu Momenten von rätselhafter Zeitlosigkeit zusammenfließen, die ihren Ursprung in der vom Bewußtsein belebten Stille zu haben scheinen.
"Mit fünf oder sechs Jahren habe ich angefangen, mich vor dem Tod meiner Eltern zu fürchten", bekannte Berger in "Begegnungen und Abschiede", seinem 1991 veröffentlichten Essayband, in dem er auch das Sterben seiner Mutter beschrieb. Jetzt, im jüngsten Buch, beschreibt der Sohn, wie sie sich von der Parkbank erhebt und, außerhalb der Zeit, auf ihren Sohn zugeht. Und John Berger, der am gestrigen Sonntag achtzig Jahre geworden ist, empfängt sie so selbstverständlich wie einen willkommenen, der Stille des Schlafs entsprungenen Traum.
Berger spaziert mit seiner Mutter durch Lissabon und kauft auf einem Fischmarkt die Zutaten für ein Lieblingsgericht seines toten Vaters; in Genf hat er ein Rendezvous mit seiner Tochter Katya und besucht mit ihr Borges' Grab. Katya, so erinnert sich Berger, hatte sich mit seiner Mutter zu deren Lebzeiten gut verstanden, "denn schweigend waren sie beide tief davon überzeugt, daß der Sinn des Lebens nicht dort zu finden war, wohin man die Augen der Menschen lenkt. Nur im Verborgenen ist er zu finden", ergänzt Berger, der die Folge der scheinbar in sich abgeschlossenen Kapitel seines Buches äußerst hintergründig miteinander verknüpft: Nur das Verborgene, so einer der versteckten Fäden, die "Hier, wo wir uns begegnen" zusammenhalten, verleiht dem Sichtbaren seine wahre Gestalt.
In Krakau, im Londoner Stadtteil Islington und in der Grotte Chauvet in der französischen Ardèche, in Madrid ebenso wie im Südosten von Polen, wo sich für den Erzähler am Ufer des Flusses Szum abermals die Grenze zwischen Gegenwart und Vergangenheit verwischt und die Erinnerungen an das Haus im Osten von London aufleben, in dem der 1926 geborene Berger die ersten Jahre seiner Kindheit verbrachte: In "Hier, wo wir uns begegnen" durchmißt John Berger den weiten Raum des Sichtbaren, an dessen vielfältigen Erscheinungen sich seine Identität prismatisch bricht, und spürt dabei den tiefgehenden Erfahrungen seines Lebens nach. Der Szum ist wie der Fluß, der durch den Garten seines Elternhauses floß und die offenen Wunden des von den Schrecken des Ersten Weltkrieges traumatisierten Vaters wusch. "In seinem Leben war der Fluß über Jahre hinweg das Beste gewesen und das wollte er mit mir teilen", schreibt Berger, der zu Hause in Highams Park, am Ufer des Ching, über den eine kleine Zugbrücke führte, dem Vater mit der ganzen unbändigen Stärke eines Kindes zur Seite stand.
"Immer wenn er die Zugbrücke hinunterließ, borgte er sich meine Unschuld und erinnerte sich an seine eigene, die - mit Ausnahme jener Samstagnachmittage - verloren war", so Berger, dessen Schilderung der prägenden Beziehung zu seinem Vater zu den eindringlichsten Erfahrungen des Buches zählt. "An diesen Samstagnachmittagen begann eine Unternehmung, die meinen Vater und mich bis zu seinem Tode verband und die ich nun alleine fortsetze."
Bergers Romane - darunter der 1972 mit dem Booker Prize ausgezeichnete "G.", die Trilogie "Von ihrer Hände Arbeit" und "King", die Geschichte zweier gealterter Obdachloser - sind von der gleichen "widerständigen Kraft der alltäglichen Zärtlichkeit", die Berger an den Bildern Vincent van Goghs bewundert; seine zahlreichen Essays, darunter "Glanz und Elend des Malers Pablo Picasso", bezeugen einen ähnlich starken "Sinn für die Rätsel des Lebens", das gleiche von unaufgeregter Neugier und nachdenklicher Skepsis geleitete Mitgefühl, das John Berger vor allem im Ausdruck des von Velazquez gemalten Äsop erkennt. Der Anteilnahme, mit der er beispielsweise in "SauErde" die karge Existenz französischer Bauern beschreibt oder in "Geschichte eines Landarztes" das tägliche Leben in einer ländlichen Gegend am Rand der kapitalistischen Gesellschaft Englands, unterliegt dieselbe Ethik disziplinierter Menschlichkeit, die auch zwischen den Zeilen von Bergers neuem Buch aufscheint und den darin beschriebenen realen oder auch nur imaginären Begegnungen Präsenz und Wahrheit schenkt. In Krakau trifft er den in Neuseeland gestorbenen Ken, in Islington besucht er seinen Freund Hubert, um den vergessenen Namen eines Mädchens zu erfahren, das beide in den vierziger Jahren gekannt hatten.
Ken war einer der einflußreichsten Menschen in Bergers Leben, von ihm hatte er als Jugendlicher gelernt, "Grenzen zu überschreiten" und Bücher nicht allein mit den Augen, sondern mit der Wachheit und Empfindsamkeit aller Sinne zu lesen; mit Hubert, dessen Haus seit dem Tod seiner Frau von einer beredten Stille erfüllt ist, hatte Berger in den vierziger Jahren an derselben Kunstschule studiert. "Hubert", bemerkt er in einer der zahlreichen Charakterskizzen, die über die bloße Beobachtung des einzelnen hinausgehen und "Hier, wo wir uns begegnen" weniger zu einer selbstbezogenen Autobiographie als zu einer universalen Enzyklopädie menschlicher Erfahrung machen, "hatte schon immer zum Schweigen geneigt - als ob das Leben an einem Faden hinge, den ein dummes Wort durchtrennen könnte." Das Schweigen, die Stille, das Atmen, der Tod: Die behutsame Geste, mit der John Berger hier die Bilder seines Lebens berührt, stößt immer wieder durch die Membran der Sprache und tastet jenseits von ihr nach der wortlosen Existenz.
"Jedes Bild", so Berger in "Das Kunstwerk. Der Ort der Malerei", seinem Anfang der achtziger Jahre entstandenen Essay über das Verhältnis zwischen einem Gemälde und dem Raum, in dem es betrachtet wird, "beginnt mit dem Wort ,hier'." Jedes Bild, ergänzt er in "Begegnungen und Abschiede", biete eine greifbare, augenblickliche, unverbrüchliche, kontinuierliche Gegenwart. In "Hier, wo wir uns begegnen" - "Here Is Where We Meet": Schon der Titel evoziert die "sinnliche Spannung" der Körperlichkeit, die Berger in seinen Essays als ursprüngliche Qualität eines Bildes beschreibt - überführt er die Literatur in die Sphäre der Malerei; Bergers Prosa strebt anstrengungslos nach der gleichen Visualität und Greifbarkeit, die die Arbeit eines jeden Malers bedingt, und bewahrt die Gegenwart des Vergänglichen mit den Augen der Kunst.
Seine Mutter erhebt sich in Lissabon von der Bank und tritt langsam auf ihn zu; in einem Hotel in Madrid steigt sein kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verstorbener Lehrer langsam eine Treppe herab und ist jenseits von Zeit und Erinnerung eine visuelle Erfahrung von unmittelbarer Präsenz. Das Leben - vergänglich: So mahnen die Beschreibungen einiger Früchte, die Berger nach der Art eines Vanitas-Stillebens in die Mitte seines Buchs eingefügt hat. Bilder jedoch, davon erzählt schließlich nicht zuletzt das schöne Kapitel über die vor mehr als dreißigtausend Jahren entstandenen Malereien in der Tropfsteinhöhle bei Vallon-Pont d'Arc, überdauern die Zeit wie ein Fels. "Die Felszeichnungen", heißt es in "Hier, wo wir uns begegnen", John Bergers außergewöhnlichem und eigentlich sogar recht bedeutendem Buch, "sind, wo sie sind, damit sie im Dunkel existieren. Sie waren für das Dunkel gedacht, und sie wurden im Dunkel verborgen, damit das, was sie verkörpern, alles Sichtbare überdauern konnte und - vielleicht - ein Überleben verspricht."
THOMAS DAVID
John Berger: "Hier, wo wir uns begegnen". Aus dem Englischen übersetzt von Hans Jürgen Balmes. Carl Hanser Verlag, München 2006. 223 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
'A triumph ... Sad, reflective and peppered with unforgettable images ... it makes us stop and take a breath. It makes us see the world afresh. Makes us do a double-take' Guardian