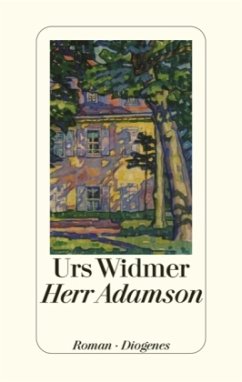Wer erzählt, ist noch bei Trost: Urs Widmer folgt in seinem neuen, wundersamen Roman erneut den Fährten seiner abenteuerlichen Poetik und tut dem Tod einen echten Gefallen.
Von Richard Kämmerlings
In Basel gab es keine Indianer." Wirklich nicht? Wer weiß das schon mit Gewissheit. Nur der Tod ist sicher. So ist es vielleicht klüger, sich auf die Begegnung mit einem Indianer vorzubereiten und also beispielsweise die Sprache der Navajo zu lernen, die so kryptisch ist, dass die Amerikaner sie als geheimen Funkcode im Zweiten Weltkrieg einsetzten. Als Kind war der Erzähler in Urs Widmers neuem Roman noch von der Allgegenwart der Indianer überzeugt, schließlich war er ja selbst Häuptling Rasender Hirsch, im verbotenen und verwunschenen Garten der Nachbarsvilla. Beim Erwachsenen wich die Gewissheit dem Zweifel und der leisen Ahnung, dass es Indianer wohl doch nur im Wilden Westen gibt, wo diese inzwischen als Tankwarte, Grundschullehrer und Busfahrer arbeiten.
Ein alter Mann, vierundneunzigjährig, sitzt im Jahr 2032 auf einer Bank im Garten und erzählt in ein Aufnahmegerät, "so groß wie zwei Stück Zucker". Für seine Enkelin Anni ist die Geschichte gedacht, die von den Indianerspielen seiner Kindheit handelt und von Herrn Adamson, dem der achtjährige Junge einst in diesem Garten begegnet ist. Herr Adamson, ein netter, freundlicher, etwas kauziger Greis, den man sich unwillkürlich ein bisschen wie Pan Tau aus dem tschechischen Kinderfilm vorstellt, taucht eines Tages wie aus dem Nichts auf und verschwindet ebenso plötzlich wieder, stellt seltsame Fragen, etwa nach dem Datum oder nach dem Wohlergehen irgendwelcher Nachbarn und spielt in der Zwischenzeit mit dem Kind Verstecken wie ein Jungspund. Herr Adamson ist ein Toter.
Und Herr Adamson wird zum Führer durch das Reich der Toten, er weiht den mit roten Ohren lauschenden Jungen in die Geheimnisse des Jenseits ein, die zugleich seine eigene Präsens erklären. Jeder Mensch wird im Augenblick seines Todes zum "Vorgänger" eines anderen: "Du siehst mich, weil ich in genau dem Augenblick gestorben bin, in dem du zur Welt gekommen bist. Ich sage nicht Jahr oder Tag oder Stunde oder Minute oder Sekunde. Ich sage Augenblick." Und jeder "Nachfolger" wird von ebendiesem Vorgänger abgeholt, wenn es Zeit ist. Für jeden trägt der Tod also ein anderes Antlitz, und da jeder Todesbote aussieht wie in seiner eigenen Sterbestunde, kann man von Glück sagen, wenn es ein netter, alter Mann auf Socken ist (der Tod ereilte Herrn Adamson beim Schuhmacher).
Ein Eingang zur ziemlich betriebsamen Unterwelt liegt nun zufällig im Garten des Nachbarn, doch dass Herr Adamson den Jungen behelligt, der doch noch fast eine Ewigkeit vor sich hat, hat einen anderen Grund. Denn Herr Adamson, dessen Tod ganz überraschend kam, will seiner geliebten Enkelin ein Vermächtnis zukommen lassen, wozu er - sozusagen aus jenseitsphysikalischen Gründen - die Hilfe eines Lebenden braucht. Gemeinsam spürt man eine Aktentasche mit offenbar wertvollem Inhalt auf; die gesuchte Empfängerin aber findet man nicht.
Urs Widmer, selbst Jahrgang 1938, lässt den uralten Mann auf der Bank ein Märchen erzählen, eine Geschichte für die Enkel und Urenkel, in dem der nahe Tod nur noch einen ganz kleinen Stachel hat. Zum Abschied von seinen Lieben gibt er dem Rekorder das langgehütete Geheimnis vom Herrn Adamson preis, der ihn vom Fortleben der Toten überzeugte. Herr Adamson war sogar, wenn auch unfreiwillig, sein Führer in der Unterwelt, sein Vergil, als der Dreikäsehoch, ganz furchtloser Indianer, ihm heimlich ins Chaos des Totenreichs folgte, auf der verzweifelten Suche nach einem kindgerechten Ausgang. Inmitten der antiken Ruinen von Mykene erreichte man mit letzter Kraft wieder die Oberwelt, wo sich wiederum herausstellte, dass auch den Mykene-Ausgräber Schliemann mit Herrn Adamson und seiner Enkelin eine komplizierte Geschichte verbindet.
Die aberwitzige Konstruktion, die im weiteren Verlauf noch in ein amerikanisches Reservat der Navajo-Indianer führt, folgt, wie von Widmers Frühwerk her gewohnt, einer Traumlogik. Schon in der "Forschungsreise" (1974) war die Poetik des Abenteuers zugleich eine abenteuerliche Poetik. Die Unwahrscheinlichkeit der Handlung ist für dieses nur scheinbar spontane, tatsächlich in feinsten Mustern gewebte Fabulieren nicht nur kein Einwand, sondern eben ihr Thema. Im Kindesalter wie in der Nähe des Todes wird ein Wunschdenken übermächtig, das sich vor allem im Erzählen manifestieren kann - so variiert auch "Herr Adamson" den Mythos der Scheherazade, demzufolge jede neue Geschichte einen weiteren Aufschub des Todes bedeutet.
Das Buch hat selbst den Charakter einer Bilanz. Ganz beiläufig zitiert Widmer viele Motive und Topoi seines Lebenswerks herbei: Schon im "Indianersommer" (1985) wurden die ewigen Jagdgründe zum überraschenden Ziel einer Weltflucht, im "Blauen Siphon" (1992), einem von Widmers schönsten Büchern, ist der Kinosaal die lockend-bedrohliche Schwelle in eine jenseitige Welt. Ein Käferforscher und ein Saurierknochen spielen auf den "Kongress der Paläolepidopterologen" (1989) an. Außerdem lässt Widmer noch verehrte Vorbilder wie Flann O'Briens "Dritten Polizisten" vorbeischauen, dessen Fahrrad den Jungen von der Peloponnes in Windeseile zurück nach Basel trägt. Nach der glücklichen Heimkehr schickten die besorgten Eltern das Kind übrigens gleich zum Psychologen, einem "Doktor Ackermann oder Ackeret oder vielleicht auch Acklin" (der Psychoanalytiker Jürg Acklin ist selbst ein renommierter Schweizer Autor).
So verwebt Widmer seine Lebensthemen - die archäologischen Grabungen in der Erinnerung, die Suche nach Schlupflöchern im harten Gewebe der Wirklichkeit, der tiefe Ernst von Possenspiel und Maskerade und die aus Ängsten geborene Koketterie mit dem Tod - zu einem leichten Stoff, der den nackten Schrecken bedecken soll. Das Artistische und Kindlich-Clowneske, das man manchen seiner Bücher vorgeworfen hat, ist hier zur optimalen Passform einer Erzählung über den unaufhebbaren Skandal der menschlichen Vergänglichkeit geworden. "Ein Leben. Es versprach einst, schier ewig zu werden, und es ist wie ein kurzer Windstoß an mir vorbeigeweht." Herr Adamson macht es keineswegs dem Sterbenden leichter, abzutreten. Seine Existenz garantiert vielmehr den Zurückbleibenden, dass der Tod nicht das Ende ist. Und auch dessen Vermächtnis erreicht schließlich auf verschlungenen Pfaden doch noch die zunächst verfehlte Adressatin.
Trost ist der Modus dieser Erzählung, die ein Großvater seiner Enkelin und ein alter Schriftsteller seinen treuen Lesern erzählt. Einmal ist nebenbei vom "unvergesslichen Datum" des 4. September 2011 die Rede, dem Tag, an dem "die israelisch-palästinensische Versöhnung endgültig wurde". Von der Kraft frommer Wünsche lebt die ganze Geschichte. 2032 wäre Widmer so alt wie sein Erzähler, vierundneunzig; das ist noch lange hin und doch nur ein "Windstoß". Mit staunenswerter Gelassenheit spielt Widmer mit dem Wissen um die Unwahrscheinlichkeit eines guten Ausgangs, eines dauerhaften Schlupflochs aus der Welt, in der alles stirbt und für immer vergeht.
Wenn in einem Buch ganz und gar unglaubliche Dinge geschehen, wenn darin der Nahostkonflikt endet, wenn ein Basler Bub einen Saurierknochen findet und sich in Mykene verirrt oder ein Autodidakt perfekt Navajo parliert, dann kann man es schon wieder Realismus nennen, wenn auch die Toten mitten unter uns weiterleben, und sei es nur für eine Weile. In Basel gibt es keine Indianer? Wer will das wissen? Es wäre doch so schön.
Urs Widmer: "Herr Adamson". Roman. Diogenes Verlag, Zürich 2009. 208 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Ausgesprochen hingerissen hat sich Andreas Wirthensohn den burlesken Einfällen und surrealen Verwicklungen dieses Romans über den Tod hingegeben. Denn Urs Widmer gelingt es darin aus seiner Sicht auf recht unnachahmliche Weise, der Endlichkeit des Lebens ihren Schrecken zu nehmen. Bereits die Geschichte vom Jungen, der mit dem titelgebenden Herrn Adamson eines Tages demjenigen begegnet, den er auf dieser Welt bei seiner Geburt einst ablöste und der ihn einmal ins Totenreich abholen wird, bezaubert den Kritiker. Aber auch die Art und Weise, wie Urs Widmer seine Figuren und mit ihnen die Leser aufs Meer der Transzendenz und weit ins Jenseits mitnimmt, und dabei gleichzeitig ein Kindheitsparadies aufleuchten lässt, beeindruckt Wirthensohn sehr.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Die Welt des Schweizer Schriftstellers Urs Widmer war voller absurder Komik und bizarrer Weltuntergänge.« Michael Krüger / Die Zeit, Hamburg Michael Krüger / Die Zeit Die Zeit