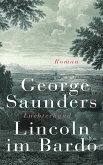Eine junge Frau wird als Nachtwächterin in einer Verpackungsfabrik eingestellt. Abend für Abend macht sie ihren Rundgang, kontrolliert die Zäune. Ein Wolf soll in das Gelände eingedrungen sein. Mit jeder Nachtschicht wird die Suche nach dem Wolf mehr zu einer Suche nach sich selbst und zur Frage nach den Grenzen, die wir ziehen, um das zu schützen, woran wir glauben."Gianna Molinari nimmt uns an Bord einer literarischen Forschungsreise zu den Terrae Incognitae der Gegenwart, nimmt uns vom vermeintlich sicheren Ufer mit ins offene Meer." Ruth Schweikert"Manche Bücher sind wie Inseln. Leser betreten sie nur kurz, aber lang genug, dass sie ihre rätselhafte Schönheit, ihren sprachlichen Bewuchs, ihre Bewohner nicht mehr missen möchten. Hier ist noch alles möglich ist genau so ein Buch." Sasa Stanisic

Drei souveräne literarische Sommer-Debüts, die je auf ihre Weise das Diktat der totalen Gegenwart abschütteln: Katharina Adler befreit ihre Urgroßmutter Ida Bauer aus dem analytischen Blick Sigmund Freuds, bei dem die junge Frau in Behandlung war. Bei Julia von Lucadou gerät das Leben einer Therapeutin selbst außer Kontrolle. Und Gianna Molinari experimentiert mit unzuverlässigem Lichteinfall rund um einen vom Himmel fallenden Mann, bis sich alle Gewissheiten vollends zerstreut haben
Es gibt literarische Debüts, die gar nichts Debüthaftes an sich haben. Romane, die man liest, ohne dabei auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass es erste Romane sind. Sie kommen mit voller Wucht als Werk daher, weshalb man ihren Autoren gerne den ohnehin zu gönnerhaft klingenden Titel der "Debütantin" oder des "Debütanten" erspart. Es sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller. In diesem Sommer: Katharina Adler, Julia von Lucadou und Gianna Molinari.
Dass ihre Bücher so viel Kraft haben, liegt auch an dem, was sie nicht sagen, worauf sie verzichten, wogegen sich die Autorinnen entschieden haben. Bei dem Buch der 1980 in München geborenen Katharina Adler jedenfalls ist das der Fall. "Ida" heißt ihr Roman. Katharina Adler ist die Urenkelin von Ida Bauer, die 18 Jahre alt war, als sie sich 1899 in Wien in der Berggasse bei Sigmund Freud in Behandlung begab - oder besser: begeben sollte. Ihr Vater, ein Bekannter Freuds, schickte sie dorthin.
Ida litt unter nervösem Husten, Stimmverlust, Bewusstlosigkeit nach Auseinandersetzungen mit dem Vater. Nach nur drei Monaten brach sie die Behandlung von sich aus wieder ab, worüber Freud nicht begeistert war. Er schrieb sein berühmtes "Bruchstück einer Hysterie-Analyse", jenen Text, in dem er in einer Fallstudie (Ida heißt bei ihm Dora) sein theoretisches Konzept der "Übertragung" entwickelte. Er bot seine ganze Phantasie auf, um an die Geheimnisse aus dem Seelenleben des ihm anvertrauten Mädchens heranzukommen, verwandelte den Text in eine Art erotische Novelle, die aufgrund der Enttäuschung über den Abbruch im letzten Teil in eine Abrechnung kippt. Der "allmächtige Erzähler Freud", der zu dem System der Männer gehört, dem sich Dora als junge Frau gegenübersieht, so hat es der Soziologe Heinz Bude gesagt, "steht am Ende ziemlich düpiert da", weil Dora - also Ida - sich diesem System der Männer verweigert.
Katharina Adler hätte der unter Stimmlosigkeit leidenden Ida Bauer nun eine Stimme geben können, indem sie ihren Roman entlang der Freudschen Fallgeschichte als Ich-Erzählung konzipiert - sprunghaft, unzusammenhängend, ungeordnet, wie Freud selbst die Erzählungen seiner Patienten zu Beginn seines Textes nennt. Und tatsächlich gibt es in "Ida" ein paar Seiten, die so geschrieben sind: "Der würde mir jetzt jederzeit, je-der-zeit, wenn seine Zeit es . . . Wie heiß die Sonne brennt, wie hell . . . Nein (. . .) Was zittert meine Hand, warum macht sie das?" Es wird auch eine Wiederholungsstruktur konstruiert, gleich mehrere Absätze beginnen mit "Noch einmal", "ein allerletztes Mal", "wirklich nur einmal noch". Aber dann ist das wieder vorbei. Zum Glück, muss man sagen.
Denn es geht in diesem Roman um sehr viel mehr als um Idas Stimme. Es geht um Ida Bauers Geschichte, die die Urenkelin ihr zurückgibt. Sie tut dies, indem sie sich gegen einen inneren Monolog ihrer Figur entscheidet und stattdessen konventionell erzählt. Sie tritt - darin besteht ihre erzählerische Pointe - auktorial gegen den auktorialen Erzähler Freud an und befreit Ida Bauer so aus der Beschränkung, immer nur Freuds Dora sein zu dürfen. Überhaupt fängt sie auch gar nicht mit Freud an, sondern 1941 in Chicago, wo Ida, als Jüdin in Wien von den Nazis verfolgt, nach einer langen Reise über das besetzte Frankreich und Casablanca ankommt, eine unwirsche, absolut nicht liebenswürdige und um Liebenswürdigkeit auch gar nicht bemühte 59-jährige Frau, die dort von ihrem Sohn empfangen wird, dem Dirigenten Kurt Herbert Adler.
Dann springt sie zurück nach Wien, ins Jahr 1900, zu genau jenem Moment, in dem Ida bei Freud die Tür zuschlägt, "aus ihrem alten Leben hinausläuft, aber ihrem neuen noch nicht entgegen". Wir erfahren vom Drama, um das es auch in der Behandlung bei Freud geht: von Idas Vater, einem Industriellen, der eine Affäre mit der Frau einer befreundeten Familie beginnt, woraufhin der betrogene Ehemann sich dafür an Ida, der 14-jährigen Tochter seines Rivalen, vergeht, sie sexuell belästigt, sie bedrängt, sie zu küssen versucht, während die Eltern ihr vorwerfen, sie würde sich das alles nur ausdenken, und alle so tun, als ginge nichts vor sich. Wir erleben die widerspenstige Ida auf Freuds Couch, auf der sie sich mit ihm einen Schlagabtausch liefert und sich im Selbstgespräch über ihn aufregt ("Ob Schachtel oder Schlüssel, alles wurde ihm zum Genital"). Wir werden Zeugen ihrer politischen Tätigkeit bei den Sozialdemokraten, verfolgen das Schicksal ihres Bruders Otto, des Begründers des Austromarxismus, und den aufsteigenden Faschismus in Österreich.
So ist der Roman vieles auf einmal: Freud-Kritik, Familiengeschichte, Epochenbild. Vor allem aber ist er der Entwurf eines Lebens, wie es gewesen sein könnte: "Ida" ist eine Fiktion. Freuds Fallgeschichte der Dora, sagt uns Katharina Adler, ist es aber auch.
"Zu Beginn der Geschichte der Psychologie glaubte man lange, die Kindheit sei entscheidend für die Formung der menschlichen Psyche. Ich selbst zweifelte während meiner Ausbildung an der modernen Psychologie und ihrer strikten Ausklammerung der Kindheit. Mittlerweile kommt mir mein Beharren auf der Betrachtung der Vergangenheit absurd vor. Was mein Leben heute bestimmt, ist nicht meine Kindheit am Institut, nicht meine Jugend auf der Wirtschaftsschule. Nicht meine Arbeit als Wirtschaftspsychologin in der Stadt. Ich lebe auf die einzige Weise, auf die es sich zu leben lohnt: in der Gegenwart."
Wir befinden uns, zur Gegenwart verdammt, in der Zukunft, im Roman "Die Hochhausspringerin" der 1982 in Heidelberg geborenen Filmwissenschaftlerin und Schriftstellerin Julia von Lucadou. Die Welt ist unterteilt in eine hocheffizient gestaltete, hypermoderne Megacity, in der jede Bewegung und jedes gewechselte Wort der in ihr wohnenden Selbstoptimierer von Überwachungskameras dokumentiert werden und alles mit Trademark-Symbolen durchkommerzialisiert ist: Fotoserien, Apps, Energydrinks, Kleidungsstücke, Begriffe. Und in eine jenseits einer Mauer beginnenden Peripherie mit schlechten, staubigen Straßen und grauen Blockbauten, in denen unkontrollierte Menschenmassen zu Hause sind. Wenn die Leistungsbilanz stimmt, hat man in der Stadt Anrecht auf Wohnraum; stimmt sie nicht, fliegt man raus in die Peripherie.
Zu Beginn aber stimmt die Leistungsbilanz bei Riva Karnovsky noch, der Hochhausspringerin, zwanzig Jahre alt, auf dem Höhepunkt ihrer Schönheit, die glitzernd mit gespanntem Körper und weit geöffneten Augen in einem "FlysuitTM" auf dem Dach eines Gebäudes steht. Eine Leistungssportlerin unter Kontrolle, jeder Muskel ist gespannt. Dann tritt sie vor und lässt sich in die eintausend Meter tiefe Schneise vor sich zum "Highrise DivingTM" nach unten gleiten, um im erhabenen Gefühl der Schwerelosigkeit den Tod zu überwinden.
Warum genau dann plötzlich nichts mehr stimmt, ist von außen ohne weiteres nicht zu erkennen: Riva, der Star mit Millionen Fans, erscheint nicht mehr zu Trainingseinheiten, wirkt unmotiviert und traurig, postet nichts mehr, verlässt die Wohnung nicht, beschließt, auch nicht mehr zu springen, was zugleich einen Vertragsbruch mit der Firma bedeutet, deren Aushängeschild sie ist. Und was diese Firma dazu veranlasst, eine Psychologin zu engagieren, die in einem Büroturm vor einem Bildschirm sitzt und Riva mit dem Auftrag beobachtet, sie wieder funktionstüchtig zu machen.
So hören wir Riva reden, verfolgen ihre Bewegungen und Handlungen aus den verschiedensten Blickwinkeln. Doch nehmen wir sie - abgesehen von ein paar Tagebuchfetzen - immer nur vermittelt durch das wahr, was die Psychologin anhand von Überwachungskameras erfassen kann. Wie Katharina Adler verzichtet dabei auch Julia von Lucadou auf die "Ich"-Stimme. Und man versteht hier bald, warum: Nicht Riva, sondern die Psychologin wird zur eigentlichen Hauptfigur des Romans. In der Beobachtung gerät ihr Leben allmählich außer Kontrolle.
"Mein Ranking in der Call-a-CoachTM-Applikation auf meinem Tablet aktualisiert sich sofort. Ich habe sowohl in der Kundenbewertung als auch bei der Bewertung durch den Auftraggeber im Trackingpool den Höchstwert erhalten. Es wird nur noch wenige Coachings brauchen, bis ich im Profil zum Master-Coach aufsteige." Der Slang der "Hochhausspringerin" ist markentechnisch so konsequent durchdekliniert, dass es an manchen Stellen fast weh tut, man oft aber auch einfach lachen muss, weil es einem gar nicht so weit weg erscheint von dem, was man manchmal so hört. Je mehr man dem artifiziellen Sound des modernen Marktes folgt, der nur Oberfläche ist, desto größer wird der Wunsch nach Poesie und Geschichte, dem Julia von Lucadou aber natürlich nicht nachkommt. Ihr Roman ist wie die Versuchsanordnung einer Welt, in der die totale Gegenwart Vorschrift ist und Erinnerung ein Vergehen, das geahndet wird.
Ein Mann fällt vom Himmel. Er springt nicht, er fällt. Ein anderer beobachtet ihn dabei in "Hier ist noch alles möglich", dem Roman der 1988 in Basel geborenen Gianna Molinari. Er ist früh aufgestanden an diesem Morgen, hat sich angezogen, gefrühstückt, den Rucksack und sein Gewehr genommen und ist aus dem Haus zum Wald gegangen. Er blickt durch das Fernglas über das Feld und sieht etwas fallen. "Es war groß. Es war ungemein schnell." Aber er erkennt nicht, dass es ein Mensch ist. Das stellt sich erst später heraus: "An der Stelle, an der der Mann auf den Boden aufprallte, dort, wo er später gefunden wurde, steht jetzt ein Kreuz."
Wer sich bei der "Hochhausspringerin" nach Poesie sehnt, ist bei Gianna Molinari gerade richtig. Ihr Roman ist wie eine kleine Schule der Wahrnehmung mit irritierenden Effekten, Rätseln und unzuverlässigem Lichteinfall. Eine junge Frau bewirbt sich als Nachtwächterin in einer Verpackungsfabrik, auf deren Gelände ein Wolf gesichtet wurde. "Falls Sie einen Wolf sichten, bitten wir Sie, uns dies umgehend zu melden", sagt man ihr. Während ihrer Schichten soll sie eine Fallgrube ausheben. Weder ist klar, ob es diesen Wolf wirklich gibt und wie gefährlich er tatsächlich ist, noch, warum der Chef, den sie mit hängenden Schultern über das Gelände gehen sieht, sie überhaupt eingestellt hat. Versucht er die Schließung der Fabrik immer noch zu verhindern? Ist, solange Nachtwachen ihre Runden drehen, für ihn seine Fabrik noch als Fabrik zu bezeichnen?
Gianna Molinari versucht einen Raum in der Wirklichkeit zu erkunden. Dabei fügt sie ihrer Erzählung auch Fotos und Skizzen hinzu. Doch je mehr Perspektiven sie sammelt, desto mehr zerstreuen sich die Gewissheiten. Dazu gehört auch der vom Himmel fallende Mann, den es tatsächlich gegeben hat. Er geht auf den wahren Fall eines im Jahr 2010 in seinem Versteck im Fahrwerk eines Flugzeugs erfrorenen Flüchtlings zurück, der aus Afrika, wahrscheinlich Kamerun, nach Europa wollte. Bei der Landung fiel er kurz vor Zürich "vom Himmel".
Was sehen wir, wenn wir den Himmel betrachten und etwas fallen sehen, aber einen Menschen zu erkennen nicht imstande sind?, fragt Gianna Molinari. Was war das für ein Mensch? Woher kam er? Und welche Geschichte hatte er? Gegen die Geschichtsvergessenheit treten alle drei Autorinnen an.
JULIA ENCKE.
Katharina Adler: "Ida". Rowohlt, 512 Seiten, 25 Euro.
Julia von Lucadou: "Die Hochhausspringerin". Hanser Berlin, 286 Seiten, 19 Euro.
Gianna Molinari: "Hier ist noch alles möglich". Aufbau, 192 Seiten, 18 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
» Gianna Molinaris Debüt ist ein erstaunlicher Text, der bildhaft wirkt und uns dazu auffordert, aufmerksam zu bleiben. « Robert Walser-Preis 2018 Robert Walser-Preis 2018 20180704