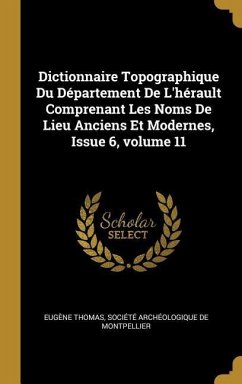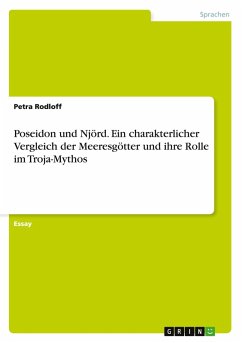Der Diskurs über die altägyptischen Hieroglyphen, von den Griechen bis zur Moderne, behandelt die Grundfragen abendländischer Grammatologie, über die man wenig weiß, wenn man den Reichtum an Theorien, Gedanken und Phantasien außer Acht läßt, der in diesem Diskurs gespeichert ist. Hier ging es um grundlegende Probleme der Kultur und ihrer Zeichen. Im Mittelpunkt stand ganz allgemein das Verhältnis von Schrift, Sprache, Denken und Wirklichkeit. Die Hieroglyphen galten als eine vollkommene, weil ebenso natürliche wie universale Bildsprache und als Heilung der babylonischen Sprachverwirrung, zugleich aber auch als Zeichen einer untergegangenen Kultur, eines verschwundenen Ur-Wissens und einer verlorenen Bedeutung. Die Faszination dieses Diskurses dauert auch nach Champollions Entzifferung und Entzauberung der Hieroglyphen ungebrochen fort. Die semiotischen Grundfragen der Kultur sind durch Champollion keineswegs gelöst worden, und es ist der Hieroglyphendiskurs, in dem diese Grundfragen an jeder Medienschwelle mit neuer Dringlichkeit gestellt werden. Der vorliegende Band will der unerschöpflichen Fruchtbarkeit des Hieroglyphendiskurses in seinen Wandlungen nachspüren. Die Thematik reicht von den historischen ägyptischen Schriftzeichen bis in die Literatur- und Kunst-, die Medien- und Filmtheorie des 20. Jahrhunderts. Mit Beiträgen von: Aleida und Jan Assmann, Stefan M. Maul, Soichiro Itoda, Michael Friedrich, Carlo Severi, Ulrich Gaier, Moshe Barasch, Marcus Kiefer, Franz Mauelshagen, Jürgen Trabant, Barbara Hunfeld, Christian J. Emden, Gabriele Rippl, Lena Christolova, Joachim Paech
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Als spannend und größtenteils gelungen bezeichnet Wilhelm Schmidt-Biggemann den von den "Erinnerungsexperten" Jan und Aleida Assmann herausgegebenen Sammelband über die Entstehung der Schriftkultur, genauer gesagt: die Entstehung der Schrift aus dem Bild. Die Herausgeber vermeiden den Fehler solcher üblicherweise aus Tagungsbeständen bestückten Sammelbände, lobt Schmidt-Biggemann, dass die verschiedenen Aufsätze kein Ganzes ergäben; außerdem verzichteten die meisten Verfasser auf einen ungenießbaren kulturwissenschaftlichen Jargon. Allerdings sollte man nach Meinung des Rezensenten die Texte nicht unbedingt in der vorgeschlagenen Reihenfolge lesen, sondern ethnologisch-anthropologisch umgruppieren: Schmidt-Biggemann empfiehlt mit den Beiträgen von Carlo Severi über die Bilderschrift der Kuma-Indianer und von Stephan M. Maul über die assyrisch-babylonische Keilschrift zu beginnen. Bloß die Texte über die Romantik und die Moderne wirkten "fahrig und ortlos", erhebt Schmidt-Biggemann Einwände, seines Erachtens ist dies symptomatisch für die dem Thema eigene Tendenz zur Begriffsentgrenzung, die sich ab der Goethezeit abzeichnen würde.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH