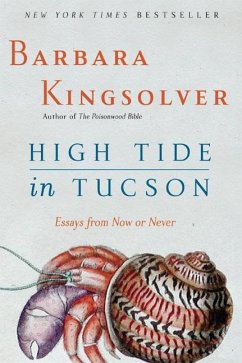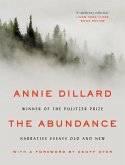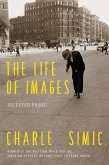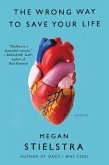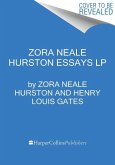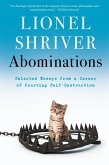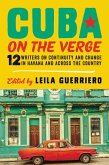The bestselling author of Pigs in Heaven and Animal Dreams now turns her talents to the world of nonfiction in an exciting, illustrated collection of 25 essays. Beautifully packaged, and featuring original illustrations by well-known artist Paul Micocha, these wise lessons on the urgent business of being alive run the gamut of topics, from motherhood to the history of provate property to the suspended citizenship of human beings in the Animal Kingdom. NPR sponsorship.
"There is no one quite like Barbara Kingsolver in contemporary literature," raves the Washington Post Book World, and it is right. She has been nominated three times for the ABBY award, and her critically acclaimed writings consistently enjoy spectacular commercial success as they entertain and touch her legions of loyal fans. In High Tide in Tucson, she returnsto her familiar themes of family, community, the common good and the natural world. The title essay considers Buster, a hermit crab that accidentally stows away on Kingsolver's return trip from the Bahamas to her desert home, and turns out to have manic-depressive tendencies. Buster is running around for all he's worth -- one can only presume it's high tide in Tucson. Kingsolver brings a moral vision and refreshing sense of humor to subjects ranging from modern motherhood to the history of private property to the suspended citizenship of human beings in the Animal Kingdom. Beautifully packaged, with original illustrations by well-known illustrator Paul Mirocha, these wise lessons on the urgent business of being alive make it a perfect gift for Kingsolver's many fans.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
"There is no one quite like Barbara Kingsolver in contemporary literature," raves the Washington Post Book World, and it is right. She has been nominated three times for the ABBY award, and her critically acclaimed writings consistently enjoy spectacular commercial success as they entertain and touch her legions of loyal fans. In High Tide in Tucson, she returnsto her familiar themes of family, community, the common good and the natural world. The title essay considers Buster, a hermit crab that accidentally stows away on Kingsolver's return trip from the Bahamas to her desert home, and turns out to have manic-depressive tendencies. Buster is running around for all he's worth -- one can only presume it's high tide in Tucson. Kingsolver brings a moral vision and refreshing sense of humor to subjects ranging from modern motherhood to the history of private property to the suspended citizenship of human beings in the Animal Kingdom. Beautifully packaged, with original illustrations by well-known illustrator Paul Mirocha, these wise lessons on the urgent business of being alive make it a perfect gift for Kingsolver's many fans.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Mit "Demon Copperhead" stellt sich Barbara Kingsolver in die Tradition von Dickens und Grass. Aber ist dieses Werk wirklich der große Roman über die Appalachen, den sie zu schreiben vorhatte?
Der Roman ist, soweit die Kategorie überhaupt noch irgendeine Aussagekraft hat, eine Sache des Bürgertums. Für die Lektüre, um vom Schreiben noch gar nicht zu sprechen, braucht es Zeit und Geld, die Möglichkeit des Rückzugs, innere und äußere Ruhe, ja, überhaupt eine Wertschätzung fürs Erzählen und die Sprache. Und das umso mehr, als der Griff zum Smartphone, unserem aufmerksamkeitsheischenden Dauerbegleiter, einen viel unmittelbareren Kick verspricht. Ohne eine gewisse Disziplin kann die Lektüre eines längeren Prosawerks, wenn es denn überhaupt zu ihr kommt, zu einer unangenehm zähen Angelegenheit werden.
Die Tatsache, dass sich die Gegenwartsliteratur in den vergangenen Jahren mit besonderer Intensität der westlichen Abstiegsgesellschaft zugewendet hat, wirft vor diesem Hintergrund Fragen auf. Sie betreffen nicht die Herkunft der Autoren, also inwiefern sie mit ihrer eigenen Vergangenheit "beglaubigen" können, was sie in ihren Büchern schildern. Dieser Logik sollte man sich, wenn man sich nicht über sie lustig machen will wie jüngst die großartige Filmposse "American Fiction", am besten ohnehin verweigern. Fraglich ist vielmehr das poetische Verfahren, der bemerkenswert ungebrochene Realismus dieser Bücher, die oft ganz oben auf den Listen der Literaturpreisjurys stehen: Seht, wie diese armen Leute hausen und leben, den Schmutz, die Ausweglosigkeit! Die soziale Distanz wird dadurch nicht verringert, im Gegenteil, man badet entweder in wohligem Mitgefühl oder in der behaglichen Gewissheit, den "Marginalisierten" endlich "eine Stimme" zu geben. Beides ist unangenehm.
Barbara Kingsolver zählt in den Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten zu den prominentesten Autorinnen, während sie im deutschsprachigen Raum noch relativ unbekannt ist. Sie erzählt in ihrem Roman "Demon Copperhead", für den sie den Pulitzerpreis erhielt, von einer Jugend in den Neunziger- und frühen Zweitausenderjahren im südwestlichen Virginia. Hier, in den Appalachen, gab es früher einmal Bergbau, der für einen gewissen Wohlstand sorgte, bevor mit seiner Stilllegung der soziale Niedergang einsetzte. Soziales Elend, dysfunktionale Familien, Kriminalität und Drogen prägen seither das Leben. In der Presse, aus der im Roman zitiert wird, ist vom einem "Schandfleck" die Rede, einem "Schmutzstreifen", dessen Bewohner als "Hinterwäldler", als "Rednecks" bezeichnet werden.
In dieser Gegend wird Demon, Kingsolvers Held, in ein Dasein hineingeboren, dessen Stationen von Anfang an vorgezeichnet sind: eine Kindheit in Gewalt und Armut, der frühe Tod der "Junkie-Mom", wechselnde Sorgeberechtigte und Pflegefamilien, die den Jungen auf je eigene Weise ausbeuten, ja sogar körperlich an den Existenzrand bringen. Auf eine längere Phase relativer Stabilität, in der der Junge zum Star des Footballteams an seiner Highschool wird, folgt schließlich, nach einer heftigen Sportverletzung, der Totalabsturz. Demon beginnt, Tabletten zu schlucken, insbesondere das mit krimineller Energie vermarktete Schmerzmittel Oxycontin, und wird dadurch zu einem frühen Opfer der amerikanischen Opioid-Krise, deren reale katastrophale Folgen bis in unsere Gegenwart reichen, mit 100.000 Toten allein in den Jahren 2021/22.
Nur ganz langsam fängt sich Demon wieder, nach dem traurigen Krepieren der Freundin an einer Überdosis Morphin, der Verstrickung in beschaffungskriminelle Machenschaften und der zeitweisen Verlagerung des Wohnsitzes in einen heruntergekommenen Chevrolet Impala. Dabei hilft ihm nicht nur eine Reha-Maßnahme, sondern mehr noch sein Talent als Comiczeichner, dem er zunächst als Amateur im Netz nachgeht, bevor es ihm einen Buchvertrag und am Ende auch einigen Erfolg einbringt. So endet die Geschichte unerwartet optimistisch.
Erzählerisch tragen soll den Roman eine schlichte Schafft-er's-schafft-er's-nicht-Dynamik. Über 300 oder 400 Seiten hinweg mag das hinreichen, auf mehr als 800 verliert sie aber irgendwann an Wirkung. In seiner Sprache folgt das Buch einem beinharten Realismus, den Dirk van Gunsteren in ein überzeugendes Deutsch gebracht hat, gepaart mit einer kritischen Gesellschaftsanalyse, die man gerade in ihren (regional-)historischen Herleitungen, bis hin zur sogenannten Whiskey-Rebellion von 1774, mit Interesse liest. Alles in allem folgt Kingsolvers Buch gängigen Verfahren der internationalen Gegenwartsliteratur, wie sie beispielsweise in den viel gelesenen Romanen des schottisch-amerikanischen Schriftstellers Douglas Stuart, besonders in seinem mit dem Booker-Preis ausgezeichneten Debüt "Shuggie Bain" (F.A.Z. vom 24. November 2021), umgesetzt sind.
Der Gefahr, einen Wohlfühlroman für die Mittelklasse geschrieben zu haben, die sich durch einen mitleidig-schaudernden Blick in den sozialen Abgrund der eigenen, zwar angefochtenen, aber immer noch erheblichen Privilegien vergewissert - dieser Gefahr ist die erfahrene Autorin Barbara Kingsolver allerdings entgangen. So weist sie ihre Erzählung gleich zweifach als Erzählung aus und stellt ihren Realismus dadurch unter Vorbehalt: zum einen, indem sie ihren Roman als eine Charles-Dickens-Adaption ausgibt und ihren Protagonisten an einer Stelle sogar ausdrücklich von "David Copperfield" sprechen lässt; und zum anderen, indem sie die Geschichte auf einen therapeutischen Erzählakt zurückführt, auf eine literarische Hausaufgabe, die Demon von einer Psychologin in seiner Entzugseinrichtung gestellt worden ist. Ob Kingsolver Grass' "Blechtrommel" zur Kenntnis genommen hat? Realität und Fiktion, intertextuelle Beziehungen und überformende Erinnerung bilden in diesem Roman ein unauflösliches Ganzes.
Der "große Roman von Appalachia", den Kingsolver mit ihrem Buch vorlegen wollte, wie sie in einem Interview erklärte - er ist ein Roman im starken Wortsinne. Die Möglichkeit, ihn allzu rasch mit der Wirklichkeit kurzzuschließen, bietet er nicht, trotz der rauen, der Realität abgehörten Sprache des Ich-Erzählers. Dass ihr Buch in stilistischer, formaler und narrativer Hinsicht so reizlos ist, verwundert dabei nur auf den ersten Blick. Auch das ist wohl Teil des allgegenwärtigen "Midcults" (F.A.Z. vom 25. November 2022): die Leser im Gefühl zu wähnen, an der literarischen Hochkultur teilzuhaben (Dickens! Zitat! Selbstreflexivität!), ohne daraus irgendwelche, gar herausfordernde Konsequenzen abzuleiten. So demokratisch dieser Ansatz sein mag, so uncouragiert ist er zugleich. Dass es solche Romane geben darf und soll, sei gar nicht bestritten. Aber muss man sie gleich mit den allerhöchsten Ehrungen versehen? KAI SINA
Barbara Kingsolver: "Demon Copperhead". Roman.
Aus dem Englischen
von Dirk van Gunsteren. dtv, München 2024.
832 S., geb., 26,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.