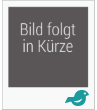Nicht lieferbar

Himmelskörper
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Freia, die junge Meteorologin aus Berlin, ahnt mehr und mehr, daß es in ihrer ach so normalen Familie nicht nur ein Geheimnis gibt, weswegen vertuscht, gelogen, verdrängt wird. Was immer Freia erfragt oder vermutet, alles scheint 1945 begonnen zu haben - an jenem bitterkalten Morgen im Krieg, als die Großmutter mit Freias Mutter, damals ein Mädchen von fünf Jahren, auf einem der letzten Schiffe aus Westpreußen über die Ostsee fliehen wollte. Freia, die jetzt selbst ein Kind erwartet, muß dieser Geschichte auf den Grund gehen, um sich von der Vergangenheit zu befreien.
Zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Paul wuchs Freia, die junge Wolkenforscherin, in einer ganz "normalen" deutschen Familie in Westberlin auf. Der Vater, Arzt und strahlender Held ihrer Kindheit, die Mutter hingegen schweigsam und seltsam schemenhaft. Wenn die Großeltern zu Besuch kommen, kreisen die Gespräche immer wieder um den Krieg und die Flucht aus Westpreußen. Freia scheint es, als wollten die Großeltern und ihre Mutter etwas verbergen. Jetzt wo Freia selbst ein Kind erwartet, beschließt sie gemeinsam mit Paul die Vergangenheit zu ergründen. Alle ihre Fragen und Vermutungen führen schließlich zu jenem Wintermorgen im Krieg, als die Großmutter mit einem der letzten Schiffe aus Westpreußen fliehen wollte. Warum nahmen sie die "Theodora" und nicht, wie so viele andere, die "Gustloff"?