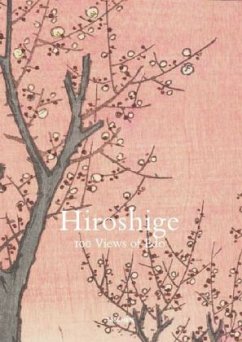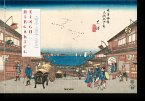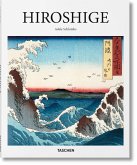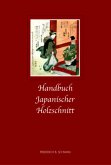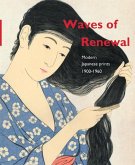Ukiyoe bedeutet wörtlich "Bilder der fließenden Welt" und bezeichnet die berühmte Kunstgattung des japanischen Holzschnitts, die im 17. Jahrhundert entstand und die bildliche Darstellung Japans in der westlichen Welt bis heute prägt. Weil sie in Massen gefertigt werden konnten, wurden Ukiyoe-Drucke häufig als Vorlagen für Fächer, Neujahrsgrußkarten und Buchillustrationen verwendet. Traditionell zeigten sie schöne Frauen, Kabuki-Theaterdarsteller, Vergnügungsszenen, das Stadtleben und Landschaften. Die Einflüsse des Ukiyoe in Europa und den USA - oft als Japonismus bezeichnet - sind allgegenwärtig, von der impressionistischen Malerei bis zu den heutigen Manga und Anime.

Mit seinen "Hundert berühmten Ansichten von Edo" übertraf Hiroshige alles, was die japanische Holzschnittkunst bis dahin hervorgebracht hatte. Es ist ein bezaubernder Spaziergang durch das frühe Tokio.
Von Freddy Langer
Tradition verpflichtet. Zumal in Japan. So trat der junge Ando Juemon nach dem Tod des Vaters gemäß den damaligen Gepflogenheiten dessen Stelle als Feuerwehrhauptmann an. Dass er zu der Zeit erst neun Jahre alt war, schien niemanden zu stören. Aber viel Spaß hatte der kleine Bub an der Position offensichtlich nicht. Vom Jahr 1811 an, nun vierzehn, nahm er bei dem Ukiyo-e-Künstler Utagawa Toyohiro Unterricht. Bald darauf wechselte er seinen Namen zu Hiroshige.
Ukiyo-e: Das waren in poetischer Sprache formuliert "Bilder der fließenden Welt" - gemeint aber war damit etwas ganz und gar Prosaisches, nämlich das Irdische, Vergängliche im Alltag des aufkommenden Bürgertums. Fern religiöser Spiritualität oder auch nur der Besinnlichkeit, widmete sich diese Kunst dem Raffinement einer Vergnügungsgesellschaft. Ihre Motive fand sie im Theater, im Teehaus und im Kreis der Kurtisanen mit ihren prachtvollen Kimonos und aufwendigen Frisuren. Als farbige Holzschnitte angeboten, wurden die Blätter zum Aushängeschild einer neuen, städtischen Kultur jenseits des Shogunats, vor allem in den beiden Metropolen Osaka und Edo, dem späteren Tokio, wo Mitte des neunzehnten Jahrhunderts bereits anderthalb bis zwei Millionen Menschen lebten.
Obwohl es sich um Massenware handelte und die Bilder nicht mehr kosteten als eine Nudelsuppe in einem Straßenrestaurant, waren die Bilder von bezaubernder Schönheit und in ihrer Farbigkeit von beachtlicher Perfektion, was freilich nicht zuletzt am handwerklichen Geschick der Drucker lag. Dennoch zogen sich Hiroshiges Lehrjahre als Maler und Zeichner bis zum Tod seines Meisters 1829 hin, dauerten also achtzehn Jahre, in denen er sich bestenfalls mit mittelmäßigen Buchillustrationen hervortat.
Dann aber, offensichtlich von den Zwängen der fremden Werkstatt befreit, legte er eine Serie nach der anderen vor - herrliche Bildfolgen, in denen er sich einem neuen Topos widmete: der japanischen Landschaft. Zuerst veröffentlichte er die "Zehn Ansichten der Osthauptstadt", dann "die "53 Stationen der Tokai-do-Straße", darauf die "69 Stationen des Kisokai-do". Immer umfangreicher wurden die Serien, fast fünftausend Bilder umfassten sie. Hiroshige wurde immer berühmter - doch die Qualität der Arbeit ließ kontinuierlich nach.
Umso erstaunlicher ist es, wie er mit seinem Alterswerk, den "Hundert berühmten Ansichten von Edo" alles übertraf, was die japanische Holzschnittkunst bis dahin hervorgebracht hatte. Im Jahr 1856 begonnen, arbeitete Hiroshige bis zu seinem Tod zwei Jahre später an der Mappe - da waren mittlerweile 120 Blätter entstanden. Manche Motive wurden schon zu seinen Lebzeiten so populär, dass sie fünfzehntausendmal gedruckt werden mussten. Und auch die europäische Kunstwelt hat sie früh entdeckt. Maler wie Whistler oder van Gogh nutzten sie als direkte Vorlagen für ihr eigenes OEuvre.
Früh hatte man begonnen, Hiroshiges Motive nach Jahreszeiten zu ordnen, um die Sehenswürdigkeiten der Stadt in den Zyklus der Natur einzubinden, fast so, als seien sie Teil eines Kreislaufs. Dieser Konvention folgt nun, aufwendig gestaltet und gedruckt, ein Band mit der gesamten Bildfolge. Es ist ein herrliches Buch, in dem man gar nicht zu blättern aufhören will. Nie, möchte man sagen, war Tokio schöner anzusehen. Im riesigen Format öffnet sich auf den ersten Blick das Panorama einer Welt der Anmut. Brücken spannen sich artig über Flüsse, Drachen hängen geduldig am Himmel, Menschen staunen vor Wasserfällen, flanieren durch eine Stadt des Wohlstands oder picknicken in weiten Parks. Oft wird dies aus der Vogelperspektive gezeigt, und immer wieder beeindruckt Hiroshige mit raffiniert gestaffelten Bildebenen. Dann schieben sich in grandiosen Kompositionen Gegenstände oder Tiere mit Macht in den Vordergrund des Bildes.
Erst der kenntnisreichen Einführung entnimmt der Betrachter, in welchen Details Hiroshige die Turbulenzen der Zeit kommentiert. Nach zweihundert Jahren der Isolation öffnete sich das Land damals unter dem Druck Amerikas dem Westen; zugleich wurde ein Großteil der Städte bei insgesamt drei schweren Erdbeben und einem Taifun zerstört. Für den Betrachter von damals waren die Blätter durchaus auch Kommentare zur Gegenwart.
"Hiroshige. Hundert berühmte Ansichten von Edo" Taschen Verlag, Köln 2008. Mit einer Einführung von Melanie Trede und Lorenz Bichler. 294 Seiten, zahlreiche Abbildungen, eine Karte. Japanische Bindung im Schmuckkasten, 100 Euro. - Alle Abbildungen sind diesem Band entnommen.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main