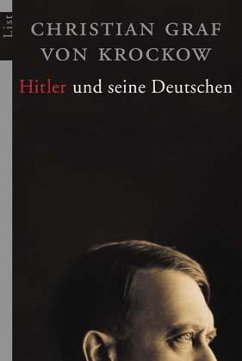Wie konnte Hitler zum "Führer" eines ganzen Volkes werden? Warum waren die Deutschen bereit, ihm in bedingungslosem Gehorsam zu folgen?
Anschaulich und mit stilistischer Brillanz nähert sich Christian Graf von Krockow, der "Nestor der Politikwissenschaften" (dpa), dem Phänomen Hitler.
Ein Thema, das ihm schon lange unter den Nägeln brennt: Mit stilistischer Brillanz nähert sich der große Publizist deutscher und preußischer Geschichte dem Phänomen Hitler. Dabei begnügt sich Krockow nicht mit der Darstellung äußerer Abläufe, sondern richtet den Blick vor allem auf die innere Befindlichkeit einer Nation, die sich in blinder Gefolgschaft ihrem "Führer" unterwarf.
Anschaulich und mit stilistischer Brillanz nähert sich Christian Graf von Krockow, der "Nestor der Politikwissenschaften" (dpa), dem Phänomen Hitler.
Ein Thema, das ihm schon lange unter den Nägeln brennt: Mit stilistischer Brillanz nähert sich der große Publizist deutscher und preußischer Geschichte dem Phänomen Hitler. Dabei begnügt sich Krockow nicht mit der Darstellung äußerer Abläufe, sondern richtet den Blick vor allem auf die innere Befindlichkeit einer Nation, die sich in blinder Gefolgschaft ihrem "Führer" unterwarf.

Christian Graf von Krockows bemerkenswertes Buch über den Allesbeherrscher Hitler und "seine" Deutschen
Christian Graf von Krockow: Hitler und seine Deutschen. List Verlag, München 2001. 423 Seiten, 44,90 Mark.
"Hitler und seine Deutschen" nennt mit betonter Akzentsetzung Christian Graf von Krockow sein jüngstes Buch. Es befaßt sich in erfreulich lesbarer Form besonders mit einer Grundfrage der Nationalsozialismus-Deutung: mit dem Problem, welches Gewicht tatsächlich der Rolle Hitlers beim Entstehen, Funktionieren und beim Untergang seines Herrschaftssystems in der schrecklichsten Periode bisheriger deutscher und europäischer Geschichte zukomme.
Schon immer wird diese Rolle höchst verschieden eingeschätzt - und ja zeitweilig durchaus unterschätzt, wie freilich von Anbeginn zugleich das nationalsozialistische Phänomen selbst. Die Diskussion stand übrigens nicht zuletzt unter dem Verdacht, daß mit dem Generalverweis auf eine Führungsallmacht Hitlers die Deutschen und ihre Historiker allzu gerne ihre Verantwortung für die Ursachen und Folgen der Diktatur von 1933 abzuwälzen suchten und dem zufällig-unerwarteten Auftauchen und verhängnisvollen Aufstieg eines politischen Un- oder Übermenschen aus Österreich zuschieben wollten.
Krockow kommt es wesentlich darauf an, jenes Problemverhältnis von Diktator und Diktatur, Akteur und Struktur, Führer und Volk im Vollzug eines totalitären, omnipotenten Systems aufmerksam und sachgerecht abzuwägen. Dieses Problem löst er auf ebenso einleuchtende wie anschauliche Weise, indem an drei herausgehobenen Stellen eine räsonierende Betrachtung über "Die Deutschen und ihr Führer" im jeweiligen Zeitraum eingefügt wird.
Im ersten Teil geht es um die Bedeutung, die sowohl den geschichtlichen Belastungen der "verspäteten" deutschen Nation (und Österreichs), der unbewältigten Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs wie der unauffällig-durchschnittlichen und doch auf besondere Weise davon betroffenen Einzelgeschichte des jungen Hitler zukommt. Und dies unter der Frage: Was wollten und erwarteten die Deutschen von ihm, als sie seinen Aufstieg aus kleinsten, zufälligen Anfängen ermöglichten? Zumal mit der ausführlichen Behandlung der Selbstschau des 35 Jahre alten gescheiterten Revoluzzers in "Mein Kampf" gelingt Krockow ein ungemein plastisches Bild des Zusammenhangs von Einzelbiographie und realen politischen Möglichkeiten im Problemfeld der Republik von Weimar; es wird die Anfälligkeit auch der geistigen Eliten mit ihrem teils spekulativ-realitätsfernen, letztlich unpolitischen, teils dezidiert "antidemokratischen Denken" (Kurt Sontheimer) klar und treffend als Hintergrund und zugleich Ansatzpunkt der Entwicklung zum Führergedanken und schließlich zum Hitlerismus selbst charakterisiert.
Krockows Darstellung des Weges zur NS-Machtergreifung und die Schilderung der "Straße der Triumphe" bis zu den "Ausblicken vom Gipfel" nach der Konferenz von München bietet dann die Gelegenheit, die Bedeutung der dezidierten Führerherrschaft auch in der teils rabiaten, teils erzschlauen Bewältigung der Krisen 1934 und 1938 zu verfolgen. In jenem letzten Friedensjahr der Kriegsdrohungen und Erpressungen wird nun aber vor allem deutlicher sichtbar, wie ernst jene - trotz "Mein Kampf" weithin verkannten - Ziele Hitlers und seines Regimes zu nehmen waren. Sie führten dazu, daß fast die Hälfte seiner Herrschaftszeit nun jenem gewollten Krieg gewidmet war, den Krockow als den "ganz anderen Krieg" beschreibt: von der Revision der Niederlage von 1918 über die Eroberung von "Lebensraum" in halb Europa bis zur betonten Vernichtung der Juden und der "Andersartigen" überhaupt, und dies auf eine in der Menschheitsgeschichte bislang unerhörte Weise. Es begann lebensgeschichtlich mit der von Hitler und seinen Helfershelfern manisch verfolgten Zwangsvorstellung, der politisch-militärische 9. November 1918 sei zu rächen und wiedergutzumachen, er dürfe sich nie mehr wiederholen.
Am geradezu magischen Datum des 9. November 1938 bot das Attentat eines jungen Juden auf einen deutschen Botschaftsbeamten in Paris den Vorwand zur Inszenierung einer barbarischen Pogromnacht gegen die Juden in Deutschland. Und ein Jahr danach - bei der "Novemberfeier" 1939 am Ort des Hitler-Putsches von 1923 im Münchener Bürgerbräukeller - ließ Georg Elsers Attentatsversuch gegen Hitler, der knapp fehlschlug, blitzartig das Widerstandsproblem in der deutschen Diktatur aufleuchten: Der Verratsvorwurf brachte jede Opposition überhaupt in tiefen Konflikt mit dem nationalen Patriotismus, nun vollends im Krieg.
Krockow geht auch auf die eher negative Beurteilung des deutschen Widerstands ein, die zumal in England noch immer verbreitet ist. So kritisiert er in der Frage, was geschehen wäre, hätten die Pläne einer Absetzung oder Beseitigung Hitlers schon 1938 oder 1939 angesichts der Kriegsfurcht Erfolg gehabt, die Behauptung des Hitler-Biographen Ian Kershaw: "Zu einer deutschen Expansion wäre es wahrscheinlich selbst dann gekommen, wenn Hitler 1938 abgesetzt oder umgebracht worden wäre." Dazu Krockow: "Aber Argumente werden dafür nicht genannt. Es ist ohnehin schwer, sie zu finden, und die Septemberkrise 1938 weist eindeutig in die Gegenrichtung."
Hitler beklagte sich im Herbst 1938 über den sozusagen von den Westmächten gestohlenen Krieg und holte ihn nach wenigen Monaten um so bedenkenloser nach. Denn was den ideologisch besessenen Hitler "magisch anzog, was er vom unscheinbaren Anfang bis zum schreckensvollen Ende immer gewollt hat, war die absolute Macht - und nichts außerdem. Dafür brauchte er den Krieg." Darin aber lag nun auch die furchtbarste Konsequenz dieser Herrschaft, durch die ein pseudodemokratisch an die Macht gelangter und durch Ausschaltung aller Kontrollen allmächtig gewordener "Führer" das eigene Volk trotz Furcht vor neuen Kriegen noch für lange, grausame Jahre irrezuleiten, durch Verführung in der Unterwerfung zu halten vermochte.
Das letzte und schlimmste Kapitel, das fast unbegreiflich "reibungslose Funktionieren" der Vernichtungs- und Katastrophenpolitik des Hitler-Regimes, sucht Krockow durch eine eindringliche Analyse der Idee absoluter Macht als Kern von Hitlers Weltanschauung und als Ziel seines Handelns überhaupt zu erklären: "Es bedeutete Herrschaft und Unterwerfung nicht im Sinne einer irgendwie gegliederten Ordnung von Obrigkeit und Untertanen, die es in der Geschichte vielfältig gegeben hat, sondern als die freie, dem Belieben anheimgestellte Entscheidung über Leben und Tod. Denn welch höhere Macht kann dem Menschen gegeben sein als solch eine Verfügung über andere Menschen? Etwas Gottähnliches - oder Satanisches - ist daran . . ."
Von den Konzentrationslagern, die früh gleichsam als sein Übungsgelände entstanden waren, entwickelte sich der "SS-Staat" schließlich bis hin zu den Todesfabriken von Auschwitz oder Treblinka. Es wütete der längst entschiedene, doch von Hitler nie verloren gegebene Krieg. Und es kam auch zum endgültigen Scheitern des deutschen Widerstands am 20. Juli 1944. Danach waren noch mehr Opfer als im ganzen bisherigen Krieg zu beklagen, während derjenige, ohne den all dies undenkbare Verbrechen und Unglück gar nicht möglich gewesen wäre, bis zum Ende im Selbstmord an seiner unverrückbaren Lebensidee festhielt.
Nie hat Hitler sich selbst, sondern immer das deutsche Volk, Österreicher inbegriffen, für schuldig erklärt, um ihm dann einseitig zuletzt noch das weitere Lebensrecht überhaupt abzusprechen. In dieser Schuldzuschreibung findet sich auch die Antwort auf die Doppelfrage, die im Titel des Buches "Hitler und seine Deutschen" enthalten ist. Zugleich liegt hier eine Erklärung dafür, daß diese "seine" Deutschen, die Hitler ehedem erst ermöglicht und dann allzu lange gestützt haben, ob nun irregeführt und schuldig geworden oder nicht, nach 1945 den Allesbeherrscher doch bald lieber vergessen wollten.
Die Lektüre des bemerkenswerten Buches ist allen zu empfehlen, die nach einer Darstellung und Erklärung des noch immer brennenden Hitler-Themas auf dem heutigen Stand der zeitgeschichtlichen Forschung suchen.
KARL DIETRICH BRACHER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main