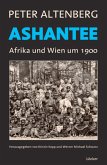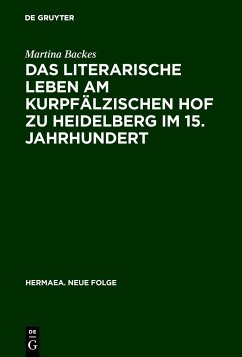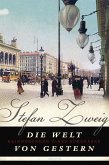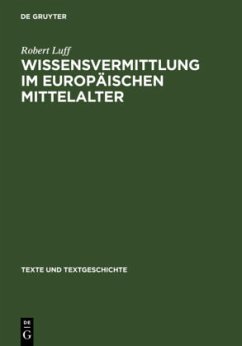Begriff, Umfang und zeitliche Erstreckung der spätmittelalterlichen Wiener Schule sind mit dieser Monographie nun klarer als bisher umrissen. Während die bislang angestellten Definitionsversuche auf religiöse Inhalte in Kombination mit der Form des volkssprachigen Prosatraktats abhoben, wurde hier ein wesentlich umfassenderer Ansatz gewählt: Ausgehend von institutionengeschichtlichen Untersuchungen konnte gezeigt werden, daß auf Initiative des österreichischen Landesherren nicht nur die Theologische Fakultät, sondern auch Juristen, Mediziner und Artisten für die Produktion universitären Schrifttums in der Volkssprache zum Nutzen (nucz / utilitas) der Landesherrschaft und der an wissenschaftlicher Bildung interessierten, nur der Volkssprache mächtigen Laien (illitterati) herangezogen wurden. Der Erfolg dieses Unternehmens war so groß, daß es nach der Anfangsphase sogar ohne die unmittelbare Unterstützung des Wiener Hofs und über dessen Einflußbereich hinaus florierte.
Das von der 1365 gegründeten Wiener Universität beförderte Hochschulwissen in deutscher Sprache für Laien wurde dabei in vielfältigen Formen präsentiert, vom Flugblatt bis zur Enzyklopädie, in Reim und Prosa, von der Handschrift bis zum Druck. Auch bildliche oder graphische Darstellungen kamen (als Momente multimedialer Performanz) zum Einsatz, um das anvisierte laikale Zielpublikum ebenso anschaulich wie zuverlässig auf universitärem Niveau zu informieren; dem gebildeten Laien, dem adligen oder stadtbürgerlichen Hausvater, den Konversen und Klosterfrauen wurde so seriöses Wissen vermittelt, um deren Lebenspraxis besser zu bewältigen. Besonders produktiv war die Wiener Schule dabei auf den Gebieten der Frömmigkeitstheologie, der Medizin und der Astronomie. Die laikalen Rezipienten der Wiener Schule wurden dabei auf wissenschaftlich gediegene und doch verständliche Weise, hierarchiekonform und häresiefrei katechesiert, umfassend in Prophylaxe und Therapie sowie wissenschaftlich fundiert medizinisch aufgeklärt und gegen gefährliche, weil den sozialen Frieden störende, astrologische Irrlehren mit seriöser Astronomie gewappnet. Dieser 'aufklärende' Impetus gegen Häresie und superstitio, gegen medizinische und astrologische Scharlatanerie ist aber nicht nur pro populo zu werten, sondern - ebenso wie mit volkssprachigen Anleitungen zum rechten Regieren und strategischen Kriegsführen - in erster Linie zum Nutzen der Landesherrschaft und deren Bemühen um stabile politische Verhältnisse zu sehen (hierin trifft sich die Wiener Schule mit der Universitätsgründung der Luxemburger). Dementsprechend zielte das Bildungsprogramm der Wiener Schule neben den politischen Eliten auch auf den frommen Untertan, der gegen hussitische Irrlehren immun war, auf den umsichtigen Hausvater, der Leben und Arbeitskraft seiner Familie, der Keimzelle des Staates, und seines Gesindes durch medizinisches Wissen sicherte, aber auch auf die gehorsamen, praktisch tätigen Konversen in den Klöstern.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Das von der 1365 gegründeten Wiener Universität beförderte Hochschulwissen in deutscher Sprache für Laien wurde dabei in vielfältigen Formen präsentiert, vom Flugblatt bis zur Enzyklopädie, in Reim und Prosa, von der Handschrift bis zum Druck. Auch bildliche oder graphische Darstellungen kamen (als Momente multimedialer Performanz) zum Einsatz, um das anvisierte laikale Zielpublikum ebenso anschaulich wie zuverlässig auf universitärem Niveau zu informieren; dem gebildeten Laien, dem adligen oder stadtbürgerlichen Hausvater, den Konversen und Klosterfrauen wurde so seriöses Wissen vermittelt, um deren Lebenspraxis besser zu bewältigen. Besonders produktiv war die Wiener Schule dabei auf den Gebieten der Frömmigkeitstheologie, der Medizin und der Astronomie. Die laikalen Rezipienten der Wiener Schule wurden dabei auf wissenschaftlich gediegene und doch verständliche Weise, hierarchiekonform und häresiefrei katechesiert, umfassend in Prophylaxe und Therapie sowie wissenschaftlich fundiert medizinisch aufgeklärt und gegen gefährliche, weil den sozialen Frieden störende, astrologische Irrlehren mit seriöser Astronomie gewappnet. Dieser 'aufklärende' Impetus gegen Häresie und superstitio, gegen medizinische und astrologische Scharlatanerie ist aber nicht nur pro populo zu werten, sondern - ebenso wie mit volkssprachigen Anleitungen zum rechten Regieren und strategischen Kriegsführen - in erster Linie zum Nutzen der Landesherrschaft und deren Bemühen um stabile politische Verhältnisse zu sehen (hierin trifft sich die Wiener Schule mit der Universitätsgründung der Luxemburger). Dementsprechend zielte das Bildungsprogramm der Wiener Schule neben den politischen Eliten auch auf den frommen Untertan, der gegen hussitische Irrlehren immun war, auf den umsichtigen Hausvater, der Leben und Arbeitskraft seiner Familie, der Keimzelle des Staates, und seines Gesindes durch medizinisches Wissen sicherte, aber auch auf die gehorsamen, praktisch tätigen Konversen in den Klöstern.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
"Institutionengeschichte, Literaturwissenschaft,Theologie und diachronische Sprachwissenschaft bilden die disziplinären Säulen, auf denen die Habilitationsschrift von Klaus Wolf ruht. Im Unterschied zur ausschließlich religiöse Belehrung und Erbauung universitätstheologischer Herkunft fokussierenden bisherigen Forschung strebt die Schrift Wolfs eine erweiterte
Bestimmung der spätmittelalterlichen Wiener Schule an, welche im engeren Sinne als "Produzentin und Distributorin deutscher 'Wissensliteratur' universitärer Provenienz" (166) definiert wird. Der erste Hauptteil besteht aus einer Beschreibung der vier Fakultäten (artistische, medizinische, juristische und theologische) sowie von deren Berührungspunkten miteinander und einer systematisierenden Analyse der Möglichkeiten von Zugehörigkeit von Gelehrten und Werken zur Wiener Schule (9-184). In ihrer Anfangsphase wird die Universität Wien unter Einbeziehung folgender Aspekte charakterisiert: a) Textproduktion und -rezeption (lateinisch und deutsch: für Laien, d. h. illiterati und Analphabeten; die juristische Fakultät unterscheidet sich von den anderen gerade darin, dass aus ihr hauptsächlich lateinisches Schrifttum hervorgegangen ist); b) Praxisbezogenheit der Wissensvermittlung (Kalenderherstellung, Pestforschung, Bekämpfung des Aberglaubens, causa reformationis, Pastoration u. v. a.) sowie der multimedialen Präsentation universitären Wissens (gesprochenes Wort, Wandtafeln, Illuminationen durch die Hofminiatorenwerkstatt, Buchdruck u. a.); c) Disseminationsnetzwerk (bestehend aus den Benediktinerklöstern Melk und Tegernsee, den Augustinerchorherrenstiften Klosterneuburg und St. Dorothea zu Wien, Lateinschulen sowie Wiener Absolventen, die im Ausland wirkten) und Berührungspunkte mit anderen universitären
Landschaften (Paris, Padua, Prag u. a.); d) "staatstragender" Funktion des habsburgischen Hofs und des österreichischen Adels (als Auftraggeber, Förderer oder Nutznießer universitären Wissens). Die Besprechung jeder Fakultät wird mit einem Ausblick in die humanistische Zeit der Wiener Schule gekrönt, außer im Fall der Theologie, die gegenüber dem humanistischen Geist immun bleibt, jedoch von der Reformation gelähmt wird.
Den Schwerpunkt des zweiten Teils stellen theologische und literaturwissenschaftliche Untersuchungen zur Wiener Frömmigkeitstheologie dar (185-256), welchen ein provisorischer Gattungskatalog im ersten Teil vorangeht: Diese differenzierte deskriptive Klassifikation umfasst katechetischen Prosatraktat, lateinische und (ver)deutschte Predigt, Bibelübersetzung, Legendendichtung (als Textebene der Verehrung von habsburgischen Patronen, mit Leopold an der Spitze), geistliche Spiele, Prosa-Fabelsammlungen und Physiologoi, Pilgerberichte, todes- und jenseitsbezogene Gattungen (Contemptus mundi-Literatur, artes moriendi und Visionsliteratur). Im zweiten Teil selbst werden zentrale Aspekte
des Wiener frömmigkeitstheologischen Schrifttums untersucht: u. a. das Experimentieren mit geeigneten Formen für die Laienkatechese oder die Entwicklung einer Liebestheologie. Partielle Überschneidungen sind allerdings anzumerken, z. B. zwischen Kap. 1.2.4 und 2.2.
Zehn repräsentative Texte aller Fakultäten der Alma mater rudolphina werden im dritten und letzten Hauptteil (257-363 - wobei die aus der Theologie überwiegen) sprachhistorisch, d. h. im Bezug auf ihren Beitrag zur Ausbildung der nhd. Schriftsprache bzw. Fachprosa, ausführlich analysiert. Wortschatz, Syntax, Rhetorik, Übersetzungstechnik und -rechtfertigung sind die Ebenen, auf denen die Analyse durchgeführt wird. Die Wahl deutschsprachiger Texte entspricht außerdem
der Auffassung von "Wiener Schule" im Sinne einer Produzentin und Distributorin universitären Wissens für illiterati, d. h. Laien.
Die Habilitationsschrift Wolfs bildet eine hervorragende erste und allgemeine Darstellung der spätmittelalterlichen Wiener Schule unter besonderer Einbeziehung deren spezifischer Leistungen auf dem Gebiet der Frömmigkeitstheologie. Das ambitionierte Vorhaben Wolfs positioniert sich trotz einiger Redundanzen als mediävistisch interdisziplinär ausgerichtetes Referenzwerk, dessen Adressatenkreis nicht nur, aber vornehmlich historische Sprachwissenschaftler, Philologen und Theologen umfasst. Doch auch in Medizingeschichte, Antisemitismusforschung, Institutionengeschichte und Germanistik wird man es mit Gewinn lesen.
Constanza Cordoni, Wien
In: Das Mittelalter. 13 (2008). Heft 2. S. 196-197.
--------------------------------------
Bestimmung der spätmittelalterlichen Wiener Schule an, welche im engeren Sinne als "Produzentin und Distributorin deutscher 'Wissensliteratur' universitärer Provenienz" (166) definiert wird. Der erste Hauptteil besteht aus einer Beschreibung der vier Fakultäten (artistische, medizinische, juristische und theologische) sowie von deren Berührungspunkten miteinander und einer systematisierenden Analyse der Möglichkeiten von Zugehörigkeit von Gelehrten und Werken zur Wiener Schule (9-184). In ihrer Anfangsphase wird die Universität Wien unter Einbeziehung folgender Aspekte charakterisiert: a) Textproduktion und -rezeption (lateinisch und deutsch: für Laien, d. h. illiterati und Analphabeten; die juristische Fakultät unterscheidet sich von den anderen gerade darin, dass aus ihr hauptsächlich lateinisches Schrifttum hervorgegangen ist); b) Praxisbezogenheit der Wissensvermittlung (Kalenderherstellung, Pestforschung, Bekämpfung des Aberglaubens, causa reformationis, Pastoration u. v. a.) sowie der multimedialen Präsentation universitären Wissens (gesprochenes Wort, Wandtafeln, Illuminationen durch die Hofminiatorenwerkstatt, Buchdruck u. a.); c) Disseminationsnetzwerk (bestehend aus den Benediktinerklöstern Melk und Tegernsee, den Augustinerchorherrenstiften Klosterneuburg und St. Dorothea zu Wien, Lateinschulen sowie Wiener Absolventen, die im Ausland wirkten) und Berührungspunkte mit anderen universitären
Landschaften (Paris, Padua, Prag u. a.); d) "staatstragender" Funktion des habsburgischen Hofs und des österreichischen Adels (als Auftraggeber, Förderer oder Nutznießer universitären Wissens). Die Besprechung jeder Fakultät wird mit einem Ausblick in die humanistische Zeit der Wiener Schule gekrönt, außer im Fall der Theologie, die gegenüber dem humanistischen Geist immun bleibt, jedoch von der Reformation gelähmt wird.
Den Schwerpunkt des zweiten Teils stellen theologische und literaturwissenschaftliche Untersuchungen zur Wiener Frömmigkeitstheologie dar (185-256), welchen ein provisorischer Gattungskatalog im ersten Teil vorangeht: Diese differenzierte deskriptive Klassifikation umfasst katechetischen Prosatraktat, lateinische und (ver)deutschte Predigt, Bibelübersetzung, Legendendichtung (als Textebene der Verehrung von habsburgischen Patronen, mit Leopold an der Spitze), geistliche Spiele, Prosa-Fabelsammlungen und Physiologoi, Pilgerberichte, todes- und jenseitsbezogene Gattungen (Contemptus mundi-Literatur, artes moriendi und Visionsliteratur). Im zweiten Teil selbst werden zentrale Aspekte
des Wiener frömmigkeitstheologischen Schrifttums untersucht: u. a. das Experimentieren mit geeigneten Formen für die Laienkatechese oder die Entwicklung einer Liebestheologie. Partielle Überschneidungen sind allerdings anzumerken, z. B. zwischen Kap. 1.2.4 und 2.2.
Zehn repräsentative Texte aller Fakultäten der Alma mater rudolphina werden im dritten und letzten Hauptteil (257-363 - wobei die aus der Theologie überwiegen) sprachhistorisch, d. h. im Bezug auf ihren Beitrag zur Ausbildung der nhd. Schriftsprache bzw. Fachprosa, ausführlich analysiert. Wortschatz, Syntax, Rhetorik, Übersetzungstechnik und -rechtfertigung sind die Ebenen, auf denen die Analyse durchgeführt wird. Die Wahl deutschsprachiger Texte entspricht außerdem
der Auffassung von "Wiener Schule" im Sinne einer Produzentin und Distributorin universitären Wissens für illiterati, d. h. Laien.
Die Habilitationsschrift Wolfs bildet eine hervorragende erste und allgemeine Darstellung der spätmittelalterlichen Wiener Schule unter besonderer Einbeziehung deren spezifischer Leistungen auf dem Gebiet der Frömmigkeitstheologie. Das ambitionierte Vorhaben Wolfs positioniert sich trotz einiger Redundanzen als mediävistisch interdisziplinär ausgerichtetes Referenzwerk, dessen Adressatenkreis nicht nur, aber vornehmlich historische Sprachwissenschaftler, Philologen und Theologen umfasst. Doch auch in Medizingeschichte, Antisemitismusforschung, Institutionengeschichte und Germanistik wird man es mit Gewinn lesen.
Constanza Cordoni, Wien
In: Das Mittelalter. 13 (2008). Heft 2. S. 196-197.
--------------------------------------