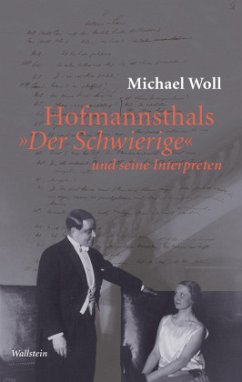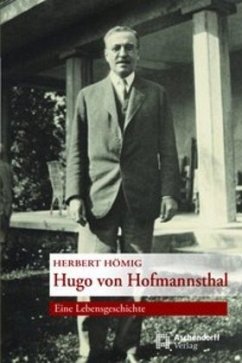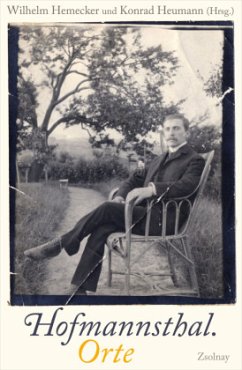Hofmannsthal
Ein moderner Dichter unter den Philologen. Habil.-Schr.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
König bestimmt Hofmannsthal als Kulturdichter der Moderne, indem er Interpretation und Wissenschaftsgeschichte verbindet.Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) wollte der Repräsentant einer neuen Kultur sein, die er gegen die bestehenden, eklektisch zerfallenden Werte und Traditionen des Historismus konstruiert. Die Einheit dieser Kultur, für die er Goethe zum Vorbild nimmt, kann er in seinen Werken nicht mehr artistisch schaffen. Er suggeriert sie und muß sein Publikum sowie, in einem weiteren Sinn, die Forschung bezaubern. Hofmannsthal steuert die eigene Rezeption, indem er das Wissen und die...
König bestimmt Hofmannsthal als Kulturdichter der Moderne, indem er Interpretation und Wissenschaftsgeschichte verbindet.Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) wollte der Repräsentant einer neuen Kultur sein, die er gegen die bestehenden, eklektisch zerfallenden Werte und Traditionen des Historismus konstruiert. Die Einheit dieser Kultur, für die er Goethe zum Vorbild nimmt, kann er in seinen Werken nicht mehr artistisch schaffen. Er suggeriert sie und muß sein Publikum sowie, in einem weiteren Sinn, die Forschung bezaubern. Hofmannsthal steuert die eigene Rezeption, indem er das Wissen und die Begriffe der Gelehrten seiner Zeit aufgreift. Er knüpft an eine alte Tradition der Verbindung von Dichtung und Wissenschaft an, die er für seine Moderne aktualisiert. Diesen Prozeß, in welchem Hofmannsthal sowohl als Dichter als auch als Philologe agiert - als Medium zwischen seiner Kunst, der Wissenschaft und seinen Lesern - deckt König auf und interpretiert zum ersten Mal kritisch Hofmannsthals »Autophilologie«, ihre Rolle im ästhetisch-kulturellen System seiner Werke und - darauf bezogen - die Hauptlinien der Hofmannsthal-Forschung.Behandelt werden: Hofmannsthals Habilitationsschrift über Victor Hugo; Goethes Rolle in Hofmannsthals Kultur; der Kreis von Gelehrten, den er um sich bildet (Rudolf Borchardt, Konrad Burdach, Walther Brecht, Josef Nadler, Walter Benjamin, Carl Jacob Burckhardt); die Anfänge der Forschung. Im Mittelpunkt steht das dramatische Werk Hofmannsthals: »Elektra«, »Ödipus und die Sphinx«, Dramenfragmente zwischen 1914 und 1927, »Der Turm« und das Opernlibretto »Die Ägyptische Helena«. Zahlreiche unveröffentlichte Quellen werden erstmals publiziert.Link: Arbeitsstelle für die Erforschung der Geschichte der Germanistik im Deutschen Literaturarchiv Marbach
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.