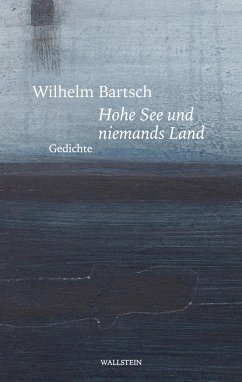Die Gedichte dieser Sammlung bilden ein Fahrten- und Welten-Buch. Eine mitunter gefährliche Reise, auf die sich der Poet begibt, über die stürmische See hin zu einem unbekannten Land. Auf dem Weg dorthin führen die Gedichte räumlich und geschichtlich in Weiten und Tiefen, den Leserinnen und Lesern begegnen vielfältigste Ereignisse und Personen. Diesem world wide web, dieser Selbst- und Weltbegegnung steht vor allem Shakespeare als großes Vorbild voran, nur dass sich das angesprochene Du in Bartschs Sonetten nicht als Mann, sondern als Frau Welt entpuppt - und das Ich versucht, den gegenwärtigen Tumulten standzuhalten.Als Jeffers` Haus sich aus der Wolke schälteNach ihrem Ich-bin-Silberpfirsich-Trick,War es ein Felskern gleich fürs Ungezählte,Fürs unplanbare Ausmaß auch von Glück.Farewell! Entmenschlicht stehn die Kliffs, die WeiteDurchströmt uns und der Seelenkompass zeigtNur hohe See und niemands Land, nur Heute,Wo Geist als Licht blitzt, das die Wahrheit scheucht.Sonst Desperados, wenn wir Banner pflanzenUnd bald zum Stückwerk machen jede Flur,Soll unser Müll nun mit dem Ozean tanzen,Nur weil zur Welt wir kommen im Big Sur?Robinson Jeffers donnert im Gehäuse -Wie kommen wir durch diese Weltraumschleuse

Wer die größte
Plattensammlung hat, schreibt die besten Songs: Wilhelm Bartsch zieht in dem Lyrikband "Hohe See und
niemands Land" die
Summe seines Könnens.
Fangen wir mit dem an, was allenfalls Angst machen könnte vor diesem Buch: den Anmerkungen, die zum Glück am Ende stehen, sodass sie den mutig mit dem ersten Gedicht Abschied Nehmenden und in See Stechenden nicht in Schrecken zu versetzen vermögen.
Wer sich wie ich für einen halbwegs gebildeten Menschen gehalten hat, der lernt hier einiges, von dem er noch nie gehört hatte: über St. Brendan und seine Fahrten, über den altnorwegischen Königsspiegel, keltische und Lakota-Mythologie, aber auch wie diese Dinge mit Dr. Faust, Cy Twombly, James Joyce, Arno Schmidt, Otto Waalkes, dem Wendland und Brandenburg verknüpft und zusammengeschaut werden können. Man merkt dann zum Glück rasch, dass es sich hier um Steigbügel für den mitdichtenden Leser handelt, für die man gar nicht dankbar genug sein kann.
Um etwas davon zu illustrieren, bitte ich Sie, liebe Leser, sich die erste, titelgebende Zeile des zweiten Gedichtes in diesem Buch laut vorzulesen (und die drei G müssen dabei bitte schön richtig knallen): "Wir fahren gen Ginnungagap."
Das ist zunächst einmal reine Lautpoesie. Liest man weiter, hört man aus diesem Satz das Bersten von Eisschollen nachknacken, eisigen Wind heulen und empfindet durch das gemeinschaftliche "Wir fahren gen" eine Ahnung von der Angstlust dessen, der ins Unbekannte aufbricht. Ob als Forscher oder Krieger, bleibt zunächst offen.
Aber wohin fahren wir? Da hilft mir dann der Anmerkungsapparat, der Ginnungagap als die senkrechten Eiswände erklärt, die in der nordischen Mythologie Niflheim begrenzen. Also sozusagen so etwas wie der eisige Tellerrand der Welt in der Vorstellung der Flatearther. Wer es mehr mit Populärmythen hält, darf an Jack Sparrow "at world's end" denken.
Und schon sind wir aus der Lautpoesie in ein komplexes Sinn- und Beziehungsgeflecht getreten. Es geht um eine Fahrt zur Grenze der Welt. Und die ist, mit Wittgenstein zu sprechen, eben auch die Grenze der Sprache. Wie der Buchtitel verspricht: eine Fahrt über hohe See zum Niemandsland, dem Land, wo noch keiner war, das also auch noch keiner mit Sprache vermessen und in Besitz genommen hat. Sucht also Bartsch im Ungemessenen eine Heimat? Gemach! Denn auf diese Frage antwortet er mit Walter Benjamin: "Die meisten suchen ewige Heimat. Andere, sehr wenige, aber das ewige Reisen."
In einem Band von 1994 gab es schon einmal ein Gedicht mit dem Titel "Gen Ginnungagap". Es ist interessant, die beiden Versionen zu vergleichen, die frühe und die dreißig Jahre später entstandene. Hier die jeweils erste Strophe, zunächst des alten: "Wir fahren lässig gen Ginnungagap, / eisbärtig und blauäugig und am Ruder / ins Joch Gebeugte - frei in Gurt und Trab / mit Kraftarmwellen, Bruder hinter Luder." Und hier das neue: "Wir fahren gen Ginnungagap / - vom Frost eisweißer Nacht zerrissene Meute. / Nichts beugt ins Joch uns und bald stößt hinab / das Drachenschiff und packt die Abgrundbeute."
Das soll genug sein: Aufs Ganze gesehen ist die Rhythmik perfektioniert, das Spiel mit den Genres und Einflüssen vom Hochkulturellen bis zum Poptrivialen noch souveräner gehandhabt, die Metaphorik noch gewagter, und alles in allem ist ein immer zunehmendes Verdichten des lyrischen Ausdrucks zu spüren - das erinnert an einen Organisten, der im Laufe der Jahre alle Register seiner Orgel verinnerlicht hat und ihnen nunmehr ein Äußerstes an Tonkombinationen zu entlocken versteht.
Womit wir wieder und noch einmal bei den Anmerkungen wären: Liest man sie durch, ohne sich vom aufgetanen Horizont verängstigen zu lassen, zeigen sie genau das auf: die Fülle von Verknüpfungen, Referenzen, Verdichtungen, das engmaschige Gewebe, das des Lesers Konzentration einfordert und ihn dafür mit Epiphanien belohnt.
Halb scherzhaft hat Bartsch einmal Keith Richards zitiert: "Wer die größte Plattensammlung hat, schreibt die besten Songs." Und Bartschs Plattensammlung ist immens. Dichtung, auch wenn sie sich wie diese nicht aus dem Universitätsseminar speist, sondern aus einem langen Leben voller Reisen, Begegnungen, Tätigkeiten und Erfahrungen, entsteht doch immer im Verhältnis zu anderer Dichtung.
Der Hafis, dem dieser nordische Divan in erster Linie antwortet, ist der Shakespeare der Sonette. Im Besonderen ist es das 87., das auch das Motto für den ganzen Band abgibt: "Farewell! Thou art too dear for my possessing!" Bei Shakespeare ein Abschied von einem geliebten Mann, bei Bartsch verbindet sich dieser Abschied (vom Narrenspiel der Welt) mit dem titelgebenden Aufbruch auf die hohe See und nach niemands Land, denn man kann die Formel im deutschen ja mit "Fahre wohl" übersetzen. Aber ich will nicht interpretieren, wo ich zitieren kann, und zwar den Autor selbst: "Auslöser (überhaupt für den gesamten Band) war das 87. Sonet, wo generell die Frage nach dem Eigentum und der Verfügungsgewalt gestellt wird - dies zieht sich dann auch als ein Leitmotiv durch das Buch, ebenso zeigt das 87. Sonett auch an, dass es um Liebeslyrik gehen wird, aber auch um grundsätzliche Bestandsaufnahmen zur Verfasstheit unserer Spezies und dann noch drittens zu unseren spirituellen Möglichkeiten (und Unmöglichkeiten). [...] Das Zeug ist noch lebendig, und bei aller Hölderlinschen heiligen Nüchternheit, die besonders hier absolut erforderlich war, reizte mich seit jeher und hier beim Shakespearesonett jetzt ganz besonders die Dialektik von freiem Spiel und stark metrischer Bindung, die ich jedoch gegebenenfalls auch 'verletzte' - letztlich ist also hier keine Vollendung möglich im unendlichen Spiel der Kontextualitäten."
56 Sonette enthält das Buch insgesamt, viele davon das Farewell-Motiv variierend, zum Beispiel dieses, das so beginnt: "Gönn ich mir diesen Sommer noch und schreibe / Von Shakespeare ab, dem Prospero des Glücks? / In Form zu bleiben, Shakespeares Form, vertreibe / Ich denn mit solchem Sturm die Zeitgeisttricks?" Und so endet: "Farewell, du Welt! Als Stern noch bleib und scheine, / Nicht dir zieh ich die Seuchenflagge hoch. / Ich werfe die im Kreis erschlaffte Leine / Der zu, die liebenslang schon mit mir zog. / Zur hohen See, zu niemands Reede hin, / Da liegen Shakespeare - Dante - Hölderlin -"
Und noch ein weiteres Zitat aus den Sonetten, hier lautet die erste Zeile: "Farewell, du Menschenwelt, ich hab dich satt!" Und es endet mit folgendem Couplet: "Du machst mich pappesatt und noch zum Schwein! / Doch so ließ ich die Liebste ja allein . . ."
Die Gedichte, ob Liebessonett oder Ballade oder Zeitkritik, sind stets tiefernste Selbstbefragungen. Schreiben ist für Bartsch immer auch Gerichtstag halten über das eigene Ich. Jeder zu schnelle, bequeme und einfache Trost angesichts des Unabwendlichen wird zurückgewiesen, gleich ob er aus der organisierten Religion oder Ideologie käme. Transzendenz scheint nur im Nu der Liebe auf. Aber Halt gibt es trotzdem - die Gewährsleute wie St. Brendan, der Reisende, der die Welten, an die er nicht glauben wollte, selbst entdecken musste, die Kollegen, wie Schiffe in der Nacht unterwegs auf ihrem eigenen Kurs, aber solidarische Grüße durch die Dunkelheit morsend: zunächst Shakespeare, aber auch andere angelsächsische Poeten wie Joyce sowie Arno Schmidt und Wolfgang Hilbig. Und dann, allen voran, die immer wieder angesprochene Gefährtin, die sich, anders als der Adressat von Shakespeares Sonetten, nicht vom Dichter abwendet, sondern ihm auf ihren Fahrten die Treue hält ("Du Wunderbarste der nicht länger Frommen, Du bist mein Segelschiff, mein Windaufkommen!").
Gemeinsame Anschauung des Schönen wie des Unnennbaren und die unzerstörbare Kraft des Bild gewordenen, des den Moment bannenden Wortes. Und natürlich ist da auch noch, wie immer bei Bartsch, der Humor, vom feinen Schmunzeln bis zum krachenden Witz, mit dem man, wie ein Hund die Nässe, die Verzweiflung aus dem Pelz schütteln kann.
Neben dem Sonett kommt auch das balladeske Element, das erzählende Gedicht nicht zu kurz, wie in dieser Irland-Impression unter der Ägide Brendans, in der die Insel Achill, die küstennah verscharrten ungetauften Kinder, die verlassenen Dörfer, der Berg Slievemore erkundet werden und Mythologie und Alltag sich durchdringen. In Bartschs Worten: "Gesichte überall, wer sah, der sah." Und: "Wir gingen, Liebste, wie durch das Gebein / Untoter, durch Koronen von Verdorrten, / vom Ruch der Pestkartoffeln noch Umflorten." Oder: ". . . im vierzigfachen Irischgrün des Slievemore. / Durch dessen Flanken striegelt Wind noch immer / mit Regen und Lichtbürsten. Und da schlenzten / sich Geisterkids noch zu die Kuhhautbälle . . ."
Immer wieder, nicht nur in den irischen Gedichten, fühlte ich mich an James Joyces Traumbuch erinnert, an "Finnegans Wake". Auch dort führt ja die Logik der Nacht zu kulturellen Zusammenschauen, Verdichtungen, Sprachüberlagerungen und Mischungen, zu einer Fülle der Referenzen, vor der man manchmal geneigt ist, die intellektuellen Waffen zu strecken. Und hier wie dort ist es ratsam, solche Passagen laut zu lesen, weil sich dann nämlich der gordische Knoten der kondensierten Sprache ganz von alleine entwirrt, zu Klang und Rhythmus wird, zu Musik, die direkt ins Blut geht.
Im Laufe des Zyklus, der Räume durchmisst, bekannte wie den mitteldeutschen oder das Wendland, keltische, nordische, aber auch Armenien oder das Amerika der Ureinwohner, und Zeiten, die Lebenszeit des Dichters, aber von dort zurück bis in mythische Urgefilde, wird der Ton, so scheint mir, apokalyptischer. Nicht verzweifelter, aber immer kopfschüttelnder angesichts des Irrsinns, der auf unserer Welt geduldet und angefacht wird. Doch heißt Apokalypse bei Bartsch eben immer auch: Katastrophe und Neubeginn. Als roter Faden zieht sich durch alle Gedichte die schon im ersten anklingende Ablehnung des Eigentums als Herrschaftsanspruch.
Seinen Pairs gilt Bartsch schon längst als einer der originellsten und bedeutendsten Lyriker der Gegenwart. Dass diese Summa seines Schaffens nun endlich auch bei einem großen Verlag erscheint, wird hoffentlich dafür sorgen, dass man dieses Buch in literarischen Buchhandlungen finden und aufblättern kann, um sich selbst davon zu überzeugen, welche Verheißung es bedeutet, auf Wilhelm Bartschs Langschiff anzuheuern und mit ihm den Anker zu lichten.
Um mit einem in Bartschs Sinne veränderten Celan-Zitat zu enden: Es sind noch Lieder zu singen jenseits der kartierten Welt.
Fahre denn wohl, Dichter, und deine Leser mit dir! MICHAEL KLEEBERG
Wilhelm Bartsch: "Hohe See und niemands Land". Gedichte.
Wallstein Verlag,
Göttingen 2024. 139 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Hellauf begeistert liest Rezensent Michael Kleeberg die Gedichte, die dieser Band Wilhelm Bartschs versammelt. Und zwar am liebsten laut, denn nur so entfalten sie laut Rezensent ihre volle Bedeutungskraft. Anhand eines close readings zeigt Kleeberg auf, wie viele Bezüge und Assoziationen in lediglich vier Worte Bartsch steckt - der reiche Anmerkungsapparat, der einige Bedeutungsebenen aufschlüsselt, gehört unbedingt zur Lektüre dazu, rät er. Der Dichter hat, da ist sich Kleeberg sicher, seine Kunst der Verdichtung in diesem Band noch einmal verfeinert und befindet sich nun auf dem Gipfel seines Schaffens. Unter anderem enthält der Band 56 Sonette, oft handeln sie von Liebe, dem Einzigen, wovon sich Bartsch Halt verspricht. Aber manchmal wird es auch balladesk-erzählend, führt Kleeberg fort, der außerdem Bezüge zu Shakespeare und James Joyce herstellt. Insgesamt scheint dem Kritiker diese Lyrik durchaus apokalyptisch grundiert, wobei bei Bartsch in jedem Ende auch ein neuer Anfang stecke. Kleeberg wünscht diesem Buch allen Erfolg der Welt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Seinen Pairs gilt Bartsch schon längst als einer der originellsten und bedeutendsten Lyriker der Gegenwart. Dass diese Summa seines Schaffens nun endlich auch bei einem großen Verlag erscheint, wird hoffentlich dafür sorgen, dass man dieses Buch in literarischen Buchhandlungen finden und Aufblättern kann, um sich selbst davon zu überzeugen, welche Verheißung es bedeutet, auf Wilhelm Bartschs Langschiff anzuheuern und mit ihm den Anker zu lichten.« (Michael Kleeberg, FAZ, 22.02.2024) »Es ist die Bartschtypische dichte Textur an Verweisen, die den Gedichten ihre raumgreifende Weite beschert. Verdichtete Gegenwart, verdichtete Textur.« (Christian Eger, Mitteldeutsche Zeitung, 28.02.2024) »Wilhelm Bartschs Sonette lesen sich, als hätte er diese lyrische Form soeben erschaffen, kein Staub klebt an den Versen, sie lesen sich geschmeidig und rhythmisch. Diese Gedichte regen den Geist an wie ein Gang durch die Natur. « (Axel Helbig, Pirckheimer-Blog, 18.04.2024) »Bartsch (gelingt es), unsere widersprüchliche Gegenwart auf seine poetischen Bühnen zu rufen (....). Dieser Band bleibt und hat noch viel Lektüre vor sich.« (Henning Ziebritzki, Schwäbisches Tagblatt, 24.04.2024) »Es sollte sich niemand scheuen, dieses Spätwerk zugleich ein Meisterwerk zu nennen.« (Michael Wüstefeld, SAX Magazin, August 2024) »Was Wilhelm Bartsch jetzt vorlegt (...) in der Fülle von verschiedenartigen Versuchen mit der Form des Sonetts, das sucht seinesgleichen in seinem bisherigen Werk, aber auch in der Gegenwartslyrik, das kann man getrost so behaupten.« (Jan Röhnert im Gespräch mit Katrin Schumacher, MDR Kultur, 18.08.2024) »Großartig (...). In seinem neuen Gedichtband (...) eröffnet uns Schriftsteller Wilhelm Bartsch einen ganzen Kosmos von literarischen und mythologischen Bezügen.« (Tomas Gärtner, Dresdner Neueste Nachrichten, 30.11.2024) »(Das Buch) ist ein bedeutender deutscher Beitrag zum alten weltliterarischen Bündnis von Poesie und Kartographie, der Besiedelung von Land und Meer durch die Sprache der Einbildungskraft.« (Lothar Müller, Laudatio zum 71. Bremer Literaturpreis)