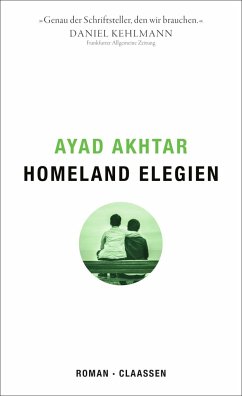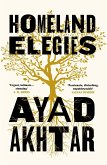"Genau der Schriftsteller, den wir brauchen." Daniel Kehlmann, FAZ
"Leidenschaftlich, verstörend, fesselnd." Salman Rushdie
"Ein herzzereißendes Porträt von Amerikanern, die von der Welt nach 9/11 zum Anderssein verbannt wurden." Jennifer Egan
Ayad Akhtars "Homeland Elegien" ist ein intelligenter Roman über den zerrütteten Zustand des heutigen Amerikas. Über ein Amerika, in dem die Ideale der amerikanischen Demokratie den Göttern der Finanzindustrie geopfert wurden und eine TV-Persönlichkeit Präsident werden konnte.
Es ist ein persönliches Memoir über die Erfahrungen von im Westen lebenden Muslimen, insbesondere nach 9/11, und eine Reflexion über die Möglichkeit einer westlichen muslimischen Identität.
Es ist die intellektuelle Biografie eines künstlerischen Ausnahmetalents und eine manchmal komische, manchmal bewegende, manchmal konfliktreiche Einwandererfamiliengeschichte.
Und nicht zuletzt erzählt der Roman mit großem Esprit und aus ungewohnter Perspektive globale Zeitgeschichte, vom Konflikt zwischen Pakistan und Indien über den ersten Afghanistan Krieg bis hin zu Osama bin Laden und dem islamistischen Terror der jüngsten Gegenwart.
"Leidenschaftlich, verstörend, fesselnd." Salman Rushdie
"Ein herzzereißendes Porträt von Amerikanern, die von der Welt nach 9/11 zum Anderssein verbannt wurden." Jennifer Egan
Ayad Akhtars "Homeland Elegien" ist ein intelligenter Roman über den zerrütteten Zustand des heutigen Amerikas. Über ein Amerika, in dem die Ideale der amerikanischen Demokratie den Göttern der Finanzindustrie geopfert wurden und eine TV-Persönlichkeit Präsident werden konnte.
Es ist ein persönliches Memoir über die Erfahrungen von im Westen lebenden Muslimen, insbesondere nach 9/11, und eine Reflexion über die Möglichkeit einer westlichen muslimischen Identität.
Es ist die intellektuelle Biografie eines künstlerischen Ausnahmetalents und eine manchmal komische, manchmal bewegende, manchmal konfliktreiche Einwandererfamiliengeschichte.
Und nicht zuletzt erzählt der Roman mit großem Esprit und aus ungewohnter Perspektive globale Zeitgeschichte, vom Konflikt zwischen Pakistan und Indien über den ersten Afghanistan Krieg bis hin zu Osama bin Laden und dem islamistischen Terror der jüngsten Gegenwart.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Ein wenig unentschieden ist Rezensentin Valérie Eiseler, ob sie dieses Buch loben soll, oder ob es unter den vielen Fragen, was daran "wahr" ist, eher so zusammenschrumpft, dass sie es keinen Roman mehr nennen will. Der Ayad Akhtar genannte Romanheld, seine Romanfamilie und Romanbekanntschaften folgen zu einem großen Teil dem Leben des Schriftstellers, das durch die Zäsur des 11.September 2001 geprägt wurde. Dieses Buch ist, wie die Kritikerin findet, eine lange "Antwort" auf die Frage, ob auch Akhtar, wie die Dramenfigur, mit der er berühmt wurde, einen "Hauch von Stolz" an jenem Tag empfunden habe. Der Autor lädt uns in seine Romanfamilie ein, um den Verwerfungen sehr unterschiedlicher Arten von Heimatliebe nachzugehen, schreibt sie. Und ob er die frustrierte Romanmutter, die sich nach Pakistan zurücksehnt, den stoischen Romanvater oder die jüngere Freundesgeneration der Romankinder vorführt, jeder leistet einen Teil der Antwort, so scheint es. Immerhin werden in dieser literarischen "Reality-Show" doch ein paar grundlegende "Wahrheiten" am Ende deutlich, urteilt die Kritikerin, die sich dem hier auch ausgedrückten Schmerz von Heimatverlust immerhin nicht entziehen will.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Ayad Akhtars autobiographische "Homeland Elegien" sezieren die Identitäten der amerikanischen Einwanderernation
Die "Great American Novel" - so der Schriftsteller John William DeForest, der 1868 den Begriff prägte - soll die literarische "Abbildung der gewöhnlichen Gefühle und Verhaltensweisen" der US-Amerikaner, das "Porträt der Seele" ihres Landes sein. Für DeForest war die gelungenste Annäherung an jenes Ideal "Onkel Toms Hütte", die Geschichte afroamerikanischer Sklaven und ihrer Eigentümer, die Harriet Beecher Stowe 1852 veröffentlichte und die bis heute inbrünstig diskutiert wird. Im Laufe der Jahrzehnte ist die Liste der Anwärter auf die literarische Ehre lang geworden. Und sie ist mit Ayad Akhtars Roman "Homeland Elegien" gerade um einen Titel reicher geworden.
In "Homeland Elegien" erzählt ein New Yorker Dramatiker namens Ayad Akhtar, Sohn eines aus Pakistan eingewanderten Ärztepaares, von seinem bemerkenswerten Werdegang. Vom Spagat zwischen der kindlichen Begeisterung seines Vaters für den "American Way of Life" (der nach Akhtar in hohem Maße darauf basiert, dass jeder auf sich allein gestellt ist, Schulden gemacht werden, um Schulden zu bezahlen - und man dabei schwört, man würde in einer strahlenden "Stadt auf dem Hügel" leben) und der Verachtung seiner Mutter alldem gegenüber. Davon, wie er durch Spekulation ein Vermögen aufbaute und verlor. Auch davon, wie er nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ein Theaterstück über Islamophobie und die Identitätskonflikte amerikanischer Muslime schrieb. Und auch davon, wie er sich in "meinem Heimatland Amerika" nie zu Hause gefühlt hat - ein Gefühl wiederum, das ihm, als er es endlich annahm, den Weg zum Erfolg als Autor ebnete.
Diese Eckdaten aus dem Leben des Protagonisten Akhtar gehören zur Biographie des Schriftstellers Akhtar. Wie dieser selbst aber erklärt hat, ist sonst vieles dessen, was sein Erzähler uns auf fesselnde und oft humorvolle Weise über sein Leben anvertraut, ausgedacht. Doch was genau? Gerade die Tatsache, dass wir es nicht wissen, gehört zur Anziehungskraft des Romans: Unser Leben, scheint er - auf sehr US-amerikanische Weise - zeigen zu wollen, ist hauptsächlich das, was wir anderen und uns selbst erzählen. Und sowieso spürt man im Laufe der Geschichte, dass die Frage nach dem Realen und dem Fiktiven hier irrelevant ist. Es gibt in "Homeland Elegien" nämlich keine Seite, die sich nicht authentisch anfühlt, keine Anekdote oder Überlegung, die nicht einen gewissen Aspekt der Realität der Vereinigten Staaten beleuchtet.
Zum Beispiel Akhtars Bericht über die wahnsinnige Sympathie, die sein Vater für Donald Trump hat. Der pakistanische Kardiologe soll Trump in den achtziger Jahren einmal behandelt haben - und seitdem fasziniert vom künftigen Präsidenten gewesen sein. Wenige Tage von einer neuen, gefürchteten Präsidentenwahl tut es weh, zu lesen, wie Akhtars Vater Trumps Lügen und Gemeinheiten, auch gegen Muslime, rechtfertigt ("Er ist ein Showman. ... Er meint es nicht so") oder verharmlost. ("Ich bete nicht, ich faste nicht, ich bin eigentlich gar kein Muslim, und für dich gilt dasselbe. Er meint uns nicht. Und außerdem war ich sein Arzt, also brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.") Diese Faszination teilen Millionen von Menschen - und sie ist, wie Trumps Erfolg selbst, das Symptom tieferer Übel. Der Roman erforscht sie.
Ebenso liest sich die Geschichte des Hedgefonds-Gründers Riaz Rind, der Akhtar zum Millionär macht, wie eine Parabel auf die paradoxen Werte der amerikanischen Gesellschaft. Rind - in dem die "New York Times" einen modernen Jay Gatsby sieht - ist der Sohn einer muslimischen Familie aus einer verarmten Arbeiterstadt in Pennsylvania. Dank seines Talents wurde er stinkreich und machte es sich zur Aufgabe, das Leben amerikanischer Muslime zu verbessern. Mit den gleichen Waffen, mit denen seiner Ansicht nach der Westen die sogenannte "muslimische Welt" knechtet - faule Kapitalanlagen und Kredite -, rächt er sich an einer Reihe von Städten für die Diskriminierung, die er dort erlebt hat.
Und auch Akhtars Geständnis, er hätte nach dem 11. September vor lauter Angst, auf der Straße angegriffen zu werden, monatelang ein Kreuz um den Hals getragen, oder wenn er manchen seiner schikanierenden Landsleuten erklären muss, sein Name käme zwar aus Ägypten, er selbst aber aus New York: Egal ob Fiktion oder nicht, es sind prägnante Pinselstriche im Gemälde der heutigen, real existierenden Vereinigten Staaten. Die Frage, die durch "Homeland Elegien" - und überhaupt Akhtars Werk - durchzieht, lautet: Wie kommt man mit einem Land klar, in dem man geboren wurde, dessen Sprache die eigene ist, auf das man stolz sein soll - und das einem ständig signalisiert, man solle dorthin abhauen, wo man angeblich herkam?
Ayad Akhtar, 1970 in New York geboren, hat bisher vier Theaterstücke, mehrere Drehbücher und zwei Romane geschrieben. 2016 war er der meistgespielte Dramatiker der Vereinigten Staaten. Für "Disgraced", sein erstes Stück aus dem Jahr 2012, bekam er den begehrten Pulitzer-Preis. Es erzählt von einem Essen, bei dem vier New Yorker - ein nicht praktizierenden muslimischer Anwalt pakistanischer Herkunft namens Amir, seine Frau, eine weiße Künstlerin, eine afroamerikanische Anwältin und ein jüdischer Kunsthändler - sich über Religion unterhalten. Als Amir irgendwann beichtet, er hätte am 11. September einen "Hauch von Stolz" verspürt, eskaliert die Diskussion. Spätere Stücke handeln etwa von der Spannung zwischen kapitalistischer Gier und islamistischem Fanatismus. Akhtar erster Roman "Himmelssucher" (2012) erzählt von einem pakistanisch-amerikanischen Jungen und seinen religiösen und familiären Konflikten.
Hinter der Frage, wie man sich zum Land verhält, das das eigene ist und einen gleichzeitig als Fremden sieht, steckt eine andere, fundamentale: Was heißt eigentlich "wir"? Sie wird in "Disgraced" besonders beklemmend gestellt. Als seine entsetzte Frau Amir fragt, worauf er denn am 11. September stolz gewesen sei, antwortet der: "Darauf, dass wir endlich gewonnen haben." "Wir?", fragt sie. "Ich glaube", antwortet Amir beschämt, "ich habe vergessen welches ,wir' ich war." In den "Homeland Elegien" hallt jetzt dieses Unbehagen wider. "Ich war", erzählt Akhtar, "nachdem ich über vierzig Jahre in Amerika gelebt hatte, noch immer bereit, mich als ,anders' zu betrachten." Später entscheidet er aufzuhören, "so zu tun, als fühlte ich mich als Amerikaner".
Wie jeder großartige Roman ist auch dieser vieles gleichzeitig: Eine intelligente und kurzweilige Geschichte von einem, der langsam versteht, wie er selbst, aber auch sein Land ticken - auch im Bezug auf das Sexuelle, wovon Akhtar mit einem genialen Sinn fürs Komische erzählt; die spannende literarische Veranschaulichung von "Trumps Triumph" als "Schleifung aller Bollwerke gegen jenes Streben nach gottgefälligem Reichtum, das offenbar die einzige verbliebene amerikanische Leidenschaft ist"; eine fast essayistische Auseinandersetzung mit den falschen Versprechen der Ökonomie, Edward W. Saids Orientalismus, Freuds Traumdeutung oder dem Ende des Goldenen Zeitalters des Islams; ein Klagegedicht - daher der Titel - über den Tod eines Traumes, der auch der Akhtars war: von der Einzig- und Großartigkeit der Vereinigten Staaten.
Vor allem aber ist der Roman - wie es ja jede "Great American Novel" zu sein hat - eine raffinierte Erkundung der "Gefühle und Verhaltensweisen", die in den letzten Jahren entstanden sind, sich entzündet und erhärtet haben und nun die "Seele" eines zerrissenen Landes bestimmen, die, wie es im Roman einmal heißt, sich selbst plündert. Diese Emotionen werden - ganz gleich, was am 3. November geschieht - die Zukunft der Vereinigten Staaten, mit allen ihren verschiedenen Identitätskrisen, weiter gestalten. Wer "Homeland Elegien" liest, wird besser verstehen, wie es dazu kommen konnte.
HERNÁN D. CARO.
Ayad Akhtar: "Homeland Elegien". Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Claassen, 464 Seiten, 24 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Ein flirrend hybrider Text im besten Sinne, Coming-of-Age-Geschichte, Essay, Erkundung, Autofiktion, Familiengeschichte, Migrationsstory, Gesellschaftsanalyse, verfasst von einem faszinierend begabten Erzähler.« Ulrich Noller DLF Kultur 20201104
Rezensent Ulrich Noller hält Ayad Akhtar für einen begabten Erzähler. Akhtars Geschichten aus seinem Leben als nur bedingt gläubiger Muslim in den USA geben Noller einen Eindruck von der Verfasstheit der amerikanischen Gesellschaft, vom Trauma des Generalverdachts gegen Muslime nach 9/11, vom Leben in der Ära Trump. Der "hybride" Text aus Essay, Entwicklungsroman, Familiengeschichte und Analyse überzeugt Noller durch Verstand, Witz und Stil.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH