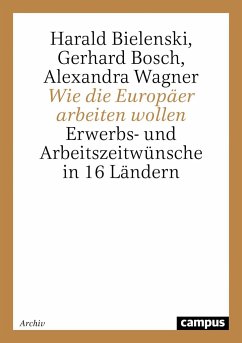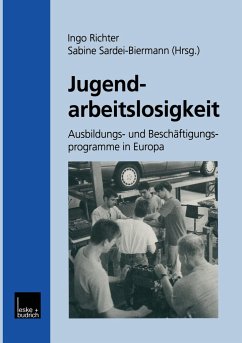Horizontale Europäisierung im Feld der Arbeitsbeziehungen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die vielfach konstatierte Asymmetrie zwischen ökonomischer und sozialer europäischer Integration hat durch die Eurokrise(n) weiter zugenommen. Neben der wachsenden grenzüberschreitenden Reichweite institutionalisierter Regulationsstrukturen im Feld der europäischen Wirtschaftspolitik ist die sozialpolitische Dimension auf supranationaler Ebene unterentwickelt. Lenkt man die Perspektive von der Ebene der Systemintegration auf Prozesse der europäischen Sozialintegration der BürgerInnen und Organisationen, werden aber zunehmende transnationale Interaktionen, Verflechtungen und Relevanzstruk...
Die vielfach konstatierte Asymmetrie zwischen ökonomischer und sozialer europäischer Integration hat durch die Eurokrise(n) weiter zugenommen. Neben der wachsenden grenzüberschreitenden Reichweite institutionalisierter Regulationsstrukturen im Feld der europäischen Wirtschaftspolitik ist die sozialpolitische Dimension auf supranationaler Ebene unterentwickelt. Lenkt man die Perspektive von der Ebene der Systemintegration auf Prozesse der europäischen Sozialintegration der BürgerInnen und Organisationen, werden aber zunehmende transnationale Interaktionen, Verflechtungen und Relevanzstrukturen zwischen wirtschaftlichen, politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren - und somit horizontale Europäisierungsprozesse - sichtbar. Im Fokus dieses Sammelbandes stehen grenzüberschreitende Austauschprozesse und Handlungsorientierungen von kollektiven Akteuren (Gewerkschaften, Euro-Betriebsräte, Unternehmen, etc.) im Feld der Arbeitsbeziehungen und deren möglicher Beitrag, die bestehende Inkongruenz von ökonomischer und sozialer Integration innerhalb der EU zu reduzieren oder zu verstärken. Die Beiträge dieses Sammelbandes orientieren sich an zwei Zielsetzungen: Zum einen wird eine analytische Perspektive auf Prozesse der transnationalen Vergesellschaftung im Bereich der Arbeitsbeziehungen entwickelt, die sich auf neo-institutionalistisch inspirierte feldtheoretische Annahmen stützt. Zum anderen wird die normative Perspektive bearbeitet, dass sich durch eine zunehmende europäische Sozialintegration auch die Möglichkeitsräume für eine vertiefte Systemintegration, das heißt eines gemeinschaftlichen Solidarsystems in der EU, eröffnen könnten