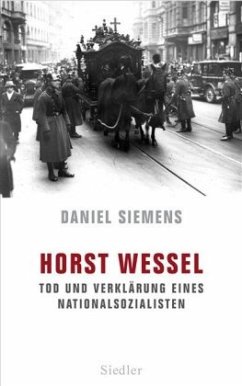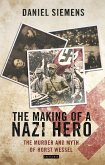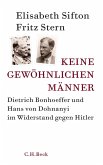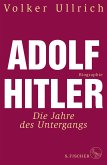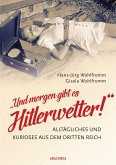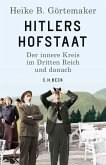Ein Kriminalfall und seine politische Karriere
Kurz nach seinem gewaltsamen Tod wurde Horst Wessel von den Nationalsozialisten zum "Blutzeugen der Bewegung" erklärt und das von ihm gedichtete "Horst-Wessel-Lied" zur offiziellen Parteihymne erhoben. Der Historiker Daniel Siemens erzählt nun die ganze Geschichte des Todes und der Verklärung Horst Wessels, die nicht mit dem Untergang des "Dritten Reichs" endete, sondern bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hineinreicht.
Am Abend des 14. Januar 1930 wurde in Berlin aus nächster Nähe auf den jungen SA-Mann Horst Wessel geschossen, der wenige Wochen später starb. Joseph Goebbels, auf Wessel bereits 1927 aufmerksam geworden, erkannte als Erster das propagandistische Potenzial des Falles: "Ein neuer Märtyrer für das Dritte Reich", notierte er am 23. Februar in sein Tagebuch. Damit hatte die Mythisierung und politische Instrumentalisierung dieses im Grunde gewöhnlichen Kriminalfalles begonnen. Horst Wessel wurde von den Nationalsozialisten zum 'Blutzeugen der Bewegung' erklärt und das von ihm gedichtete 'Horst-Wessel-Lied' zur offiziellen Parteihymne erhoben. Seine Attentäter wurden im September 1930 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Dies war den Nationalsozialisten jedoch zu milde. Von 1933 an nahmen sie blutige Rache, liquidierten den Haupttäter und verurteilten mit Sally Epstein und Hans Ziegler zwei Randpersonen, die eventuell an dem Überfall auf Wessel gar nicht beteiligt waren, wegen Mordes zum Tode. Peter Stoll, ein dritter Angeklagter, erhielt siebeneinhalb Jahre Zuchthaus. Die Todesurteile wurden am 10. April 1935 in Berlin-Plötzensee vollstreckt.
Erst nachdem am 28. Mai 2008 der Bundestag das 'Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege und von Sterilisationsentscheidungen der ehemaligen Erbgesundheitsgerichte' beschlossen hatte, hob die Berliner Staatsanwaltschaft am 9. Februar 2009 die Verurteilung von Hans Ziegler, Sally Epstein und Peter Stoll wegen Mordes an Horst Wessel auf - also 74 Jahre nach den Hinrichtungen.
Auf der Basis bislang unberücksichtigter Quellen rekonstruiert der Historiker Daniel Siemens die Hintergründe der Ermordung Horst Wessels, er erläutert, wie die Nationalsozialisten ihn zur politischen Heldengestalt stilisierten, und er untersucht die Rachemorde, die von SA, Gestapo und Justiz nach 1933 insbesondere an Kommunisten verübt wurden. Schließlich schildert Siemens, wie unterschiedlich man nach 1945 in der Bundesrepublik und der DDR mit diesem Fall umging, und er zeigt auf, warum eine Bestrafung der nationalsozialistischen Verbrechen rund um den Mordfall Wessel scheiterte.
Kurz nach seinem gewaltsamen Tod wurde Horst Wessel von den Nationalsozialisten zum "Blutzeugen der Bewegung" erklärt und das von ihm gedichtete "Horst-Wessel-Lied" zur offiziellen Parteihymne erhoben. Der Historiker Daniel Siemens erzählt nun die ganze Geschichte des Todes und der Verklärung Horst Wessels, die nicht mit dem Untergang des "Dritten Reichs" endete, sondern bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hineinreicht.
Am Abend des 14. Januar 1930 wurde in Berlin aus nächster Nähe auf den jungen SA-Mann Horst Wessel geschossen, der wenige Wochen später starb. Joseph Goebbels, auf Wessel bereits 1927 aufmerksam geworden, erkannte als Erster das propagandistische Potenzial des Falles: "Ein neuer Märtyrer für das Dritte Reich", notierte er am 23. Februar in sein Tagebuch. Damit hatte die Mythisierung und politische Instrumentalisierung dieses im Grunde gewöhnlichen Kriminalfalles begonnen. Horst Wessel wurde von den Nationalsozialisten zum 'Blutzeugen der Bewegung' erklärt und das von ihm gedichtete 'Horst-Wessel-Lied' zur offiziellen Parteihymne erhoben. Seine Attentäter wurden im September 1930 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Dies war den Nationalsozialisten jedoch zu milde. Von 1933 an nahmen sie blutige Rache, liquidierten den Haupttäter und verurteilten mit Sally Epstein und Hans Ziegler zwei Randpersonen, die eventuell an dem Überfall auf Wessel gar nicht beteiligt waren, wegen Mordes zum Tode. Peter Stoll, ein dritter Angeklagter, erhielt siebeneinhalb Jahre Zuchthaus. Die Todesurteile wurden am 10. April 1935 in Berlin-Plötzensee vollstreckt.
Erst nachdem am 28. Mai 2008 der Bundestag das 'Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege und von Sterilisationsentscheidungen der ehemaligen Erbgesundheitsgerichte' beschlossen hatte, hob die Berliner Staatsanwaltschaft am 9. Februar 2009 die Verurteilung von Hans Ziegler, Sally Epstein und Peter Stoll wegen Mordes an Horst Wessel auf - also 74 Jahre nach den Hinrichtungen.
Auf der Basis bislang unberücksichtigter Quellen rekonstruiert der Historiker Daniel Siemens die Hintergründe der Ermordung Horst Wessels, er erläutert, wie die Nationalsozialisten ihn zur politischen Heldengestalt stilisierten, und er untersucht die Rachemorde, die von SA, Gestapo und Justiz nach 1933 insbesondere an Kommunisten verübt wurden. Schließlich schildert Siemens, wie unterschiedlich man nach 1945 in der Bundesrepublik und der DDR mit diesem Fall umging, und er zeigt auf, warum eine Bestrafung der nationalsozialistischen Verbrechen rund um den Mordfall Wessel scheiterte.

ripe
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Spannend, zuverlässig und dringend notwendig findet Rezensent Manfred Gailus diese erste echte historische Aufarbeitung des Horst-Wessel-Stoffes - also der Geschichte des 1930 von seinen politischen Gegnern getöteten Rechtsextremisten Horst Wessel. Und zwar schafft aus Sicht des Rezensenten diese Arbeit des Bielefelder Historikers Daniel Siemens nicht nur Aufklärung über die Biografie die 22-jährigen Berliner Pfarrersohns, SA-Führers und Dichters der nach ihm benannten Nazi-Hymne, sondern über den gesamten Wessel-Stoff samt der "skurrilen Ausprägungen des NS-Heldenmythos'". Erstmals werde auch die Spur seiner Angehörigen bis in die Gegenwart verfolgt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ohne Übertreibung: Das interessanteste, spannendste Buch, das es zurzeit gibt!" Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung