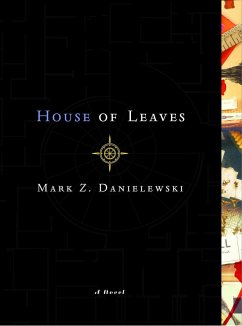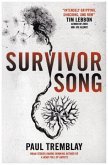Als der Pulitzer-Preisträger Will Navidson mit seiner Frau und den beiden Kindern in das Haus zieht, ahnt er nicht, wie hier sein Leben aus den Fugen geraten wird. Ganz beiläufig filmt er die alltäglichen Vorgänge in den Zimmern und Fluren; ganz beiläufig muss er feststellen, dass dieses Haus über Räume verfügt, die kein Grundriss verzeichnet.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Im Zentrum des Labyrinths wartet auf jeden Leser das eigene Ungeheuer: Mark Z. Danielewskis unheimliches Romangebäude / Von Richard Kämmerlings
Wenn man dieses Buch bis zur letzten Seite gelesen hat, ist es noch lange nicht zu Ende. Denn man muss erst wieder herausfinden, und das geht nur, indem man das Rätsel löst, das tief in ihm verborgen ist. Es wird allerdings nicht für jeden Leser das gleiche Rätsel sein, vielleicht sind es auch mehrere oder viele. Doch dass für jedes einzelne davon irgendwo, in irgendeiner der vierhundertfünfzig Fußnoten oder in einem scheinbar nebensächlichen Stück der gut hundertdreißig Seiten Anhang oder sogar im grotesk ausführlichen Index ein Schlüssel zu finden ist - davon ist man überzeugt. Oder ist man nur davon besessen?
"House of Leaves" von Mark Z. Danielewski ist ein unheimliches Buch, schon der Schutzumschlag sagt es und warnt den Leser vor dem Betreten. Der Umschlag hat recht, doch wem nützt es? Denn was das bedeutet, wo die Falle liegt, weiß man erst, wenn man selbst längst so tief verstrickt ist, dass auch eine noch so lange Rezension nicht mehr helfen kann. Denn "House of Leaves" ist ein Buch über das Lesen selbst, es erzählt von ebenden Erfahrungen, die der Leser macht, während er die Hauptfiguren bei ihrem Gang durch das Labyrinth begleitet. Am Ende wird er sich ebenso wie sie hoffnungslos darin verirrt haben und dennoch davon überzeugt sein, den Ausgang, die Lösung, die letzte Bedeutung finden zu können - wenn er nur noch gründlicher, noch tiefer sucht.
Natürlich, denn sonst würde man sich ja gar nicht darauf einlassen, ist dieses Buch noch vieles andere: Wenn David Foster Wallace mit "Infinite Jest" (1996) den letzten großen Roman des zwanzigsten Jahrhunderts geschrieben hat, dann Danielewski den ersten des einundzwanzigsten. "House of Leaves", im amerikanischen Original 2000 erschienen, ist Familienroman, Horrorthriller, Literaturwissenschaftssatire, kulturhistorischer Essay, Junkie-Story, Mythenspiel, Ehedrama, Erzählexperiment, Snuff-Gewaltporno und zugleich die ironische Reflexion all dessen: ein metafiktionaler, postmoderner Hypertextroman, der all die Computer-, Netz- und Rhizom-Metaphern einlösen will, von der die Literaturtheorie der letzten Jahrzehnte immer nur träumte. Ein Jahrhundertroman also. Und ein Haus. Doch dazu später.
Die innerste Schicht dieses Erzähluniversums ist ein Film, genannt "The Navidson Record". Darin schildert der Fotoreporter und Pulitzer-Preisträger Will Navidson die mysteriösen, grauenhaften Geschehnisse in seinem Häuschen in Virginia, in das er mit seiner Frau Karen und den beiden kleinen Kindern neu eingezogen ist. Zunächst ergeben sich nur einige winzige Unstimmigkeiten beim genauen Vermessen der Innen- und Außenwände. Doch dann findet sich eine vorher nicht vorhandene Tür in einen finsteren, offenbar ins Nichts führenden Flur. Dessen Ausmaße erweisen sich bei näherer Untersuchung als unendlich; vor allem aber scheinen sich die labyrinthisch verschlungenen Wände, Gänge, Treppen und Höhlen ständig zu verschieben und zu verzerren, so dass ein Betreten schon nach wenigen Schritten zu einem lebensgefährlichen Abenteuer wird.
Navidson organisiert ein erfahrenes, optimal, weil auch mit Kameras ausgerüstetes Forschungsteam, das systematisch und in mehreren Anläufen immer tiefer in die Unterwelt vordringt, bis die letzte Expedition in einem grausigen, tödlichen Fiasko endet. Dennoch fühlt sich Navidson vom Geheimnis seines Hauses auf beinahe magische Weise angezogen und setzt seine Erkundung, die zugleich ein avantgardistisches Filmexperiment ist, auch nach der Katastrophe und dem bitteren Zerfall seiner Familie weiter fort: Ein Albtraum wird zum Dokudrama nach dem Vorbild des Cinéma vérité. Das künstlerische Resultat, dem Genre nach ein autobiographischer Horrorthriller, wird allerdings von Beginn an nicht unmittelbar, sondern in Form einer fußnotengespickten filmwissenschaftlichen Abhandlung präsentiert, an der ein schrulliger Greis namens Zampanò bis zu seinem Tod in einer verwahrlosten Wohnung geschrieben hat. In dessen Nachlass entdeckt der hyperaktive, von Neurosen geplagte Junkie Johnny Truant das ungeordnete Manuskript und arbeitet, zunehmend besessen, an einer kommentierten Edition. Verzweifelt bemüht er sich um Informationen zu Navidson, muss aber feststellen, das der "Record" einschließlich der detaillierten bibliographischen Angaben zur Rezeption allein in Zampanòs Imagination existiert. Im Vorwort schreibt Johnny: "Wisst ihr, die Ironie bei der Sache ist - es spielt überhaupt keine Rolle, dass die Filmdokumentation, die das Herzstück dieses Buches bildet, rein fiktiv ist. Zampanò wusste vom ersten Moment an, dass es hier nicht darum geht, ob etwas real ist oder nicht real. Die Konsequenzen bleiben die gleichen." In der Tat: Johnny verirrt sich in Zampanòs Werk wie die Höhlenforscher im Haus. Und der Leser muss ihnen folgen.
Denn selbst diese vertrackte Herausgeberfiktion wird nun ihrerseits noch einmal überboten, da der labile Truant über seiner Arbeit zunehmend an Realitätsverlust leidet und ein weiteres, anonym bleibendes Editorenteam das "House of Leaves" schließlich druckfertig macht. So steigert Danielewski die Komplexität bis zur buchstäblichen Unlesbarkeit: Die Bearbeiter hinterlassen in jeweils eigenen Schrifttypen ihre Anmerkungen zu einem Text, der seiner Form nach ein kritischer Kommentar ist. Im Druckbild werden, analog zu Navidsons Filmsprache, alle Register gezogen, mit rückwärts zu lesenden oder auf dem Kopf stehenden Passagen, bis hin zu konkreter Poesie. Der Roman bildet die labyrinthische Architektur des Hauses ab. Oder andersherum: Das "Haus" ist in Wahrheit ein Text, Stein gewordener Poststrukturalismus: Seine Bedeutung ist nie zu fixieren, immer verschiebt sich eine Wand, entsteht ein neuer Durchgang, tut sich ein neuer Abgrund auf - Stephen King trifft Derrida im Folterkeller.
So treibt Danielewski mit dem Leser ein ungemein intelligentes, perfides Doppelspiel: Die Horrorstory, die dem gängigen Genremuster des verfluchten Hauses folgt, wird mit ahnungsvollen Vorgriffen und Hinweisen spannend, effektvoll und hart erzählt. Durch den sie luftdicht umwickelnden Schutzanzug der Kulturtheorie aber erscheint sie wie ein Werk der Fiktion, das seinen eigenen Gesetzen folgt. Zampanòs Relektüre des haarsträubenden Filminhalts wird zur - sehr komischen - Parodie auf kulturwissenschaftliche Phrasendrescherei, in der es dann mehr um "Metaphern", "Rollenbilder" und "weibliche Lesarten" geht als darum, dass da gerade ein Keller zum Leben erwacht und ein paar Männer zerfleischt.
Alles ist Text, die Wirklichkeit löst sich im Diskurs auf, und doch hält das Geschehen die Leser, innerhalb und außerhalb des Buches, gefangen. Denn alle jagen der Frage nach, was das Haus "eigentlich" ist: Ist es die Manifestation des Seelenzustands derjenigen, die es betreten? Ein kosmisches Phänomen, ein Paralleluniversum? Die Welt der Kunst? Ist es Gott? In den erfundenen Veröffentlichungen zum "Navidson Report" werden alle möglichen Theorien zur "Bedeutung" des Hauses aufgestellt, und auch der Realitätsstatus der Geschichte ausgiebig diskutiert. Einmal heißt es, das einzige triftige Argument für die Echtheit des Gezeigten sei, dass die Arbeit mit digitalen Effekten die Mittel des Regisseurs überstiegen haben musste: Die Simulation ist eine Frage des Budgets. Andererseits bürgen die Herausgeber am allerwenigsten für Authentizität: Zampanò, eine Borges-Figur, war seit Jahrzehnten blind, hat den Film also selbst nie sehen können und stattdessen ein Heer von Assistentinnen für die Recherche beschäftigt. Johnny gibt ohnehin gleich zu Beginn zu, nach Belieben in sein Material einzugreifen; seine durchgedrehten Fußnoten ufern zu einer Parallelhandlung mit saftigem Sex- und Gewaltanteil aus. Glaubt man aber zunächst, Johnnys Trip durch das Nachtleben von Los Angeles diene allein der Retardierung, sei nur ein Test, wie sehr sich der Leser vom "Wesentlichen" ablenken lässt, wird hier tatsächlich das zentrale Thema variiert: Schuld und Verlust.
Im "Navidson Report" taucht an zentraler Stelle das Versagen des Fotoreporters Navidson angesichts eines sterbenden Mädchens im Sudan auf, das er mit seinem preisgekrönten Bild zu einer Ikone des Leidens macht, aber nicht retten konnte. Die Kamera wird mitschuldig an dem, was sie dokumentiert - ein tragischer Zusammenhang, der sich in den tödlichen Begleitumständen des Reports wiederholt. Johnny Truant verlor seinen Vater bei einem Verkehrsunfall, seine psychisch kranke Mutter beging im Heim Selbstmord. Die Tiefe dieses Schmerzes verrät erst der Anhang. Auch erfährt man hier, dass Johnny als Kompensation für sein zerrüttetes Leben das Ende des "Reports" drastisch verfälscht haben könnte.
Im Haus verbergen sich so hinter der Fassade von Horror und Mystery seelische Dramen von Vätern und Müttern, Brüdern und Ehepartnern. Zampanò gibt dabei die größten Rätsel auf: Was geschah eigentlich mit seinen Augen? Was verbirgt sich hinter den Andeutungen, er habe einen Sohn gehabt? Woher kommt seine Obsession mit dem Mythos des Minotaurus, dessen Spuren im Manuskript er systematisch durch Schwärzungen verwischen wollte? Im Innern des Hauses scheint wie im antiken Labyrinth des Daedalus ein Monster verborgen. Manche Fährten fallen dadurch auf, dass sie sehr auffällig versteckt werden; manches deutet auf eine Beteiligung Zampanòs am Indochina-Krieg und der Schlacht bei Dien Bien Phu 1954 hin, wo die vernichtend geschlagene französische Armee zur Verteidigung ein großes unterirdisches Tunnelsystem angelegt hatte. Ein Kriegstrauma also? Oder doch eine Familientragödie? Oder beides?
Und was verbirgt der genialische Konstrukteur des Labyrinths, Daedalus/Danielewski, höchstpersönlich? Wie der Klappentext verrät, war sein Vater der aus Polen stammende Regisseur Tad Danielewski, der in der Untergrundarmee gegen die Deutschen kämpfte, gefangen genommen wurde und das Konzentrationslager überlebte. Nach dem Krieg hatte er in Amerika beim Fernsehen und als Filmemacher Erfolg. Eines seiner bekanntesten Werke war 1962 "No Exit", eine Adaption von Sartres Drama "Huis Clos"; das Drehbuch stammte von George Tabori. 1968 drehte er eine preisgekrönte Dokumentation über Afrika, auch weitere Stationen teilt er mit Navidson. "Kein Ausgang": Im Zentrum des Irrgartens trifft Danielewski auf die Lebensgeschichte seines eigenen, 1993 verstorbenen Vaters.
Und wie kommen wir hier wieder heraus? Mit solcherlei hermeneutischer Detektivarbeit bewegt man sich schon selbst tief in den verschlungenen Gängen und bodenlosen Kammern dieses Romans, stets bereit, eine weitere, bislang übersehene Abzweigung zu versuchen oder eine Magnesiumfackel in ein brunnentiefes Loch zu werfen. Einigen von Ihnen wird es, allen Warnungen zum Trotz, bald genauso gehen. Tun wir uns doch zusammen und rüsten wir die nächste Expedition aus. Dann kann es von vorne losgehen.
Mark Z. Danielewski: "Das Haus - House of Leaves". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Christa Schuenke. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2007. 827 S., 15 Abb., geb., 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main