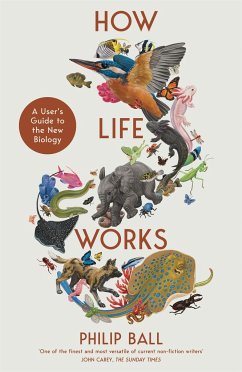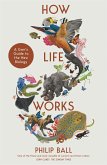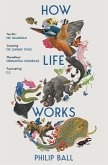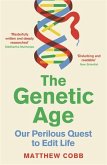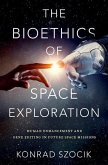Wo einst der Text des Lebens gefunden schien: Philip Ball macht mit der neuen Biologie bekannt
Die Frösche der artenreichen Familie Terrarana legen ihre Eier an Land ab, nicht in einem Gewässer. Aus ihnen schlüpfen auch keine Kaulquappen, sondern fertige Fröschchen. Wenn eine Meeresschnecke feststellt, dass sie mit Parasiten infiziert ist, "köpft" sie sich und lässt sich einen neuen Körper wachsen. Der Nutzen solcher ungewöhnlichen Strategien ist schnell gefunden: Die Frösche können Lebensräume ohne Gewässer besiedeln, Höhenlagen oder Baumwipfel etwa, die Meeresschnecke wird ihre Parasiten los. Für den Wissenschaftsautor Philip Ball zeigen sie aber noch viel mehr: Sie zeigen, wie wenig das Leben auf die bekannten Wege festgelegt ist.
In seinem jüngsten Buch hat Ball neue Forschungsergebnisse aus der Zellbiologie, aus Genetik, Proteomik, Metabolomik und anderen Disziplinen zusammengetragen und skizziert auf ihrer Basis ein ungewohntes, komplexes Bild des Lebens und seiner Entwicklung.
Es sei nicht so, dass die Geschichte, die gern erzählt wird - Gene werden abgelesen, Proteine hergestellt, und dann läuft die Zellmaschinerie -, nicht ganz korrekt sei, sie sei vielmehr völlig falsch. Ein Organismus sei kein von Genen gesteuerter Automat, keine phänotypische Ausprägung, die die Gene benutzen, um sich in die nächste Generation zu überführen, sondern eine autonome Einheit mit zahlreichen Möglichkeiten, die je nach Situation genutzt werden.
Im Mittelpunkt dieser "postgenomischen" Biologie steht entsprechend nicht die Abfolge von Basenpaaren. Stattdessen geht es um komplexe Regelkreise und Wechselwirkungen.
Nach einer Übersicht über historische Positionen zur Entstehung des Lebens von Aristoteles bis heute nimmt Ball sich zuerst die Genetik vor und zeigt, dass die Gene nicht die Chefs, sondern die Bediensteten des Organismus sind, die "nach der Pfeife der Zelle tanzen" müssen und Möglichkeiten liefern, nicht Vorschriften. Ja, es gebe ein paar Fälle, in denen man von den Genen auf den Phänotyp, also das Aussehen eines Organismus, schließen kann, etwa bei den Erbsen, mit denen Gregor Mendel experimentierte und die ihn auf die so übersichtlichen Vererbungsgesetze führten. In den allermeisten Fällen allerdings sei es nicht so einfach. So führten etwa Experimente, bei denen in Organismen einzelne Gene ausgeschaltet wurden, oft zu völlig unerwarteten Ergebnissen: Die Organismen hatten sich andere Wege gesucht, um sich zu einem lebensfähigen Ganzen zu entwickeln.
Das Human Genom Project selbst hatte zu der Einsicht geführt, dass nur etwa zwei Prozent des menschlichen Genoms tatsächlich Proteine codieren. Schnell erklärte man den ganzen Rest zu "Junk", zu Resten, die der Prozess der Evolution hinterlassen habe. Auch diese Ansicht, legt Ball dar, ist überholt: Der sogenannte Rest hat sich als zentral für die Regulationsprozesse in den Zellen erwiesen, zumindest bei komplexen Organismen. Denn bei Bakterien codieren 90 Prozent des Genoms Proteine, bei dem Würmchen C. elegans sind es nur noch 25 Prozent. Selbst die Annahme, die grundlegenden genetischen Prozesse liefen bei allen Lebewesen gleich ab, ist also viel zu einfach.
Welche Metaphern auch immer bemüht wurden, um diese Prozesse zu beschreiben, Ball zeigt, dass sie nicht trafen: In den Zellen sind molekulare Maschinen unterwegs? Keine der menschengemachten Maschinen könne es mit ihrer Komplexität aufnehmen. Eine Zelle ist wie eine Fabrik? Tatsächlich sei sie eher mit einem überfüllten Nachtclub zu vergleichen, in dem sich hin und wieder molekulare "Flashmobs" bilden, die dafür sorgen, dass die Bausteine, die einander benötigen, sich auch treffen können.
Balls Buch ist nicht nur ein Biologiekurs von den Genen über die Proteine, die Zellen und die Gewebe bis zu den Organismen. Es ist zugleich eine Reflexion über das Wesen des Lebens. Maschinen, so viel ist sicher, sind als Metaphern für die Vorgänge in der Zelle nur sehr eingeschränkt zu gebrauchen. Ball bemüht sich um andere Vergleiche: Eine Landschaft mit Bergen und Tälern ist darunter, ein Feld, auf dem viele Faktoren darüber bestimmen, ob die Ernte gelingen wird. Er ringt mit Begriffen wie Handlung, Information, Bedeutung und Zweck, die in der Wissenschaft immer irgendwie verdächtig sind, ohne die das Leben aber kaum zu beschreiben sei. Letztlich, so Ball, ist die Evolution ein Prozess, der Bedeutung in die Welt bringt. Denn genau das mache die Lebewesen aus, dass Aspekte ihrer Umwelt für sie Bedeutung haben: die Nährstoffe, auf die ein Bakterium zuschwimmt, das Licht, dem sich die Pflanze zuwendet.
Die Evolution verschiebe die "Ebenen der Kausalität", und diese Ebenen haben ihre jeweils eigenen Regeln. So schlagen sich längst nicht alle Mutationen gleich in der Überlebensfähigkeit des Organismus nieder. Vielmehr könne sich in den Genen ungestraft eine gewisse Vielfalt ansammeln, die, wenn nötig, zu schnellen Veränderungen im Organismus führen. Das gilt im Guten, also in Form besserer Anpassungen, wie im Schlechten, etwa bei der Entstehung von Krebs. Die Möglichkeit, an Krebs zu erkranken, erscheint in dieser Perspektive als der Preis dafür, als vielzelliger Organismus zu existieren. Denn die Bildung von Krebsgewebe sei für die Zellen letztlich nur ein möglicher Entwicklungsweg unter anderen.
Und warum heißt dieses enzyklopädische Werk "Gebrauchsanweisung"? Wenn die Gene eine viel geringere Rolle spielen als angenommen, hat dies auch Auswirkungen darauf, was realistischerweise von Gentherapien oder dem Sequenzieren von Tumoren zu erwarten ist. Eigentlich müssten nicht nur die Gene, sondern der gesamte Zellstoffwechsel individuell nachverfolgt werden, um zu verstehen, was etwa im Fall einer Tumorbildung abläuft und warum. Wenn dies gelänge, könnte es vielleicht einmal möglich werden, Krebszellen dazu zu bringen, sich wieder auf den "richtigen" Entwicklungsweg zu begeben, statt sie zu vernichten. Letztlich gehe es immer darum, die Ebene zu finden, auf die es gerade ankomme: Das sind manchmal die Gene, aber längst nicht immer.
Die wachsende Einsicht in die tatsächliche Komplexität der Lebensprozesse hält Forscher nicht davon ab, in diese einzugreifen. Synthetische Morphologie heißt die Disziplin, in der sie etwa an Organoiden für die Forschung arbeiten und an Xenobots, am Rechner erdachte, aus Stammzellen zusammengebastelte Wesen, von denen man nicht mehr recht weiß, ob es sich um lebende Roboter, programmierbare Organismen oder etwas ganz anderes handelt. Ihnen widmet Ball das letzte Kapitel seines überaus lesenswerten Buchs. MANUELA LENZEN
Philip Ball: "How Life Works". A User's Guide to the New Biology.
The University of Chicago Press, Chicago 2023.
552 S., Abb., geb., 32,59 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Ball is a terrific writer . . . An essential primer in our never-ending quest to understand life Adam Rutherford, The Guardian