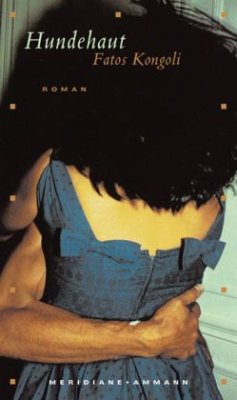Schön sind die Frauen, doch viel zu oft weinen sie in Krist Tarapis Erinnerungen. In seiner Ehe war er nicht immer ganz unschuldig an Margas Tränen, so oft betrog er sie, die er doch innig liebte. Nun ist Marga tot, der Sohn lebt schon lange in den USA, die Tochter folgt einem italienischen KFOR-Offizier in seine Heimat, und Krist bleibt allein in Tirana. Allein mit dem leeren Platz vor seinem Fenster, auf dem sich jeden Tag die anonyme Masse der Arbeitslosen der Hauptstadt versammelt, allein mit Lori, der Freundin seiner Tochter, die ihn noch immer ab und zu anruft, sich mit ihm trifft, und von der er nachts insgeheim träumt. Er fühlt sich zu Lori hingezogen, und erst nach und nach wird ihm klar, daß sie nur die letzte in einer Kette von Frauen ist, die Teil seines Lebens waren - und wieder daraus verschwanden. Sie wurden abgeholt, eingesperrt, verbannt, denunziert, und nicht selten gab es Grund zu Tränen. Im Hintergrund lauerte stets der beklemmende Schatten der kommunistischen
Diktatur. Lori ruft die Erinnerungen an diese Frauen wach, und sie nimmt Krist mit auf sein letztes Abenteuer, auf eine verhängnisvolle Reise nach St. Petersburg. Fatos Kongolis schildert den Versuch eines Lebens in Albanien: in der völligen Abschottung des Kommunismus wie in der Armut und Aussichtslosigkeit der Gegenwart, nach der politischen Wende. Hundehaut ist ein Roman, der von der Gleichzeitigkeit eines nicht zu unterdrückenden männlichen Begehrens nach Abenteuer und dem aussichtslosen Desaster der erbarmungslosen politischen Gegenwart erzählt.
Diktatur. Lori ruft die Erinnerungen an diese Frauen wach, und sie nimmt Krist mit auf sein letztes Abenteuer, auf eine verhängnisvolle Reise nach St. Petersburg. Fatos Kongolis schildert den Versuch eines Lebens in Albanien: in der völligen Abschottung des Kommunismus wie in der Armut und Aussichtslosigkeit der Gegenwart, nach der politischen Wende. Hundehaut ist ein Roman, der von der Gleichzeitigkeit eines nicht zu unterdrückenden männlichen Begehrens nach Abenteuer und dem aussichtslosen Desaster der erbarmungslosen politischen Gegenwart erzählt.

Fatos Kongolis Roman "Hundehaut"erzählt von albanischen Albträumen
Albanien - war das nicht jenes Land in den Schluchten des Balkans, in dem die Mannschaft von Kaiser Franz auf einem Stolperbolzplatz nur 0:0 spielte? Jener brutale Menschenpark, in dem ein größenwahnsinniger Diktator namens Enver Hodscha über Jahrzehnte sozialistische Persönlichkeiten erzeugen wollte, bis am Ende ein ganzes Land ruiniert war? Ein Land, das erst 1990 auf die Weltkarte des Fernsehens kam, als die Menschen es zu Tausenden flohen und sich auf schrottreifen Schiffen drängten, die italienische Häfen anliefen?
Nur wenige haben Albanien vor 1990 bereist, es war eher ein Gerücht als eine geographische Realität, und daß in diesem von der Welt abgeschnittenen Land überhaupt ein Autor wie Ismail Kadaré Romane schreiben konnte, die auch im Ausland gelesen wurden, kommt einem immer noch wie ein kleines Wunder vor. Der Schriftsteller Fatos Kongoli dagegen zog es vor, in Tirana und - während Enver Hodschas chinesischer Phase - in Peking Mathematik zu studieren, weil Zensoren sich für Infinitesimalrechnung oder Primzahlen nun mal weniger interessieren als fürs Erzählen. Kongoli, 1944 geboren, begann erst nach dem Ende des alten Regimes zu veröffentlichen; zuvor hatte er als Redakteur einer Literaturzeitschrift gearbeitet. Aber der lange Schatten der Diktatur verdüstert seine Bücher, und deshalb hat er auch seine letzten fünf Romane zu dem Zyklus "Die Kerker der Erinnerung" zusammengefaßt.
"Hundehaut", sein zweites Buch in deutscher Übersetzung, hat Elemente des Phantastischen, wenn die Traumata seines Helden sich materialisieren und in die Wirklichkeit treten. Doch es setzt in der auch ziemlich trüben Gegenwart Albaniens ein, im Jahr 1999, um immer wieder zurückzublenden in die bleiernen Zeiten des Hodscha-Regimes, und so ist es fast unvermeidlich, daß es über weite Strecken dokumentarisch wirkt. Menschen, die sich um zwei Uhr in der Nacht vorm Milchladen aufbauen und, oft vergeblich, warten, die perfiden Praktiken der Bespitzelung und die Details der Mangelwirtschaft, das kann man so genau und plastisch gar nicht erfinden. Kongolis Sprache ist dabei klar und knapp, mit gelegentlichen Einschüssen eines tiefschwarzen Humors. "Ehrlich", sagt sein trauriger Held, als man ihn als Lehrer in die Provinz versetzt, "in B. hatte man nur einen Wunsch, nämlich sich am nächsten Baum aufzuhängen."
Dieser Krist Tarapi ist zugleich die Titelfigur: Die Hundehaut, denn ein albanisches Sprichwort sagt, daß Butter, die mit einer Hundehaut in Berührung kommt, sofort ranzig wird. Krists Existenz ist trostloser als ein Hundeleben. Die Gestalten aus den Filmen, zu denen er hundsmiserable Drehbücher geschrieben hat, suchen ihn heim, er trinkt, er hat keine Arbeit, seine Frau stirbt, und der Trieb ist ihm der letzte und war ihm der einzige Trost. Er ist 55, und was ihm an erfreulicheren Erinnerungen geblieben ist, das sind seine amourösen Abenteuer, deren Abfolge Kongoli wie eine Metamorphose angelegt hat. Sie beginnt mit Krists Grundschullehrerin, für die er Kassiber zu ihrem geächteten Ehemann schmuggelte; die Tochter des bespitzelten Paares wird später Krists Geliebte, deren Tochter wiederum, die seine sexuellen Phantasien noch einmal mächtig anheizt, ist eine sehr postsozialistische Freundin von Krists Tochter.
Krist lamentiert, er neigt zu Selbstbezichtigung und Selbstmitleid, er hat irgendwie mitgemacht in all den Jahren, er hat diffuse Schuldgefühle, doch er ist zu kraftlos, um sich zu befreien. Seine Lebensenergie ist erloschen, weil es jenseits des Überlebens gar kein Leben gab, das er sinnvoll hätte führen können. Er ist so verloren wie der Held aus Kongolis Roman "Die albanische Braut" (der im Original "Der Verlorene" heißt). Er findet nicht mehr zurück, und was er zu erzählen hat, das sind lauter Szenen aus einem Albtraumthemenpark, in dem man Olivenhaine so anlegte, daß die Bäume, aus der Luft betrachtet, die Buchstaben "Enver Parti" bildeten, aus einem Land, in dem heute angesichts enormer Geburtenraten zwar schimärenhafte großalbanische Träume blühen, das aber zugleich eines der ärmsten in Europa geblieben ist. Man hat dabei nie das Gefühl, Fatos Kongoli übertreibe; da ist eher der Eindruck, er zwinge sich noch zur Nüchternheit, weil die Wirklichkeit so unfaßbar war, daß die Literatur sich vor zuviel Erfindung hüten muß.
PETER KÖRTE
Fatos Kongoli: "Hundehaut". Roman. Aus dem Albanischen von Joachim Röhm. Ammann-Verlag, Zürich 2006. 296 Seiten, 19,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main