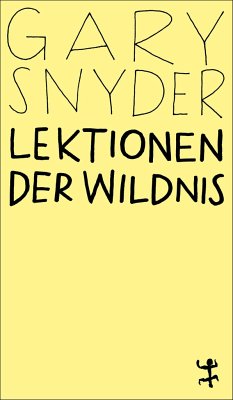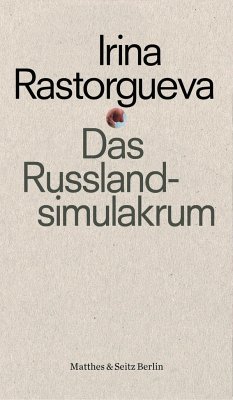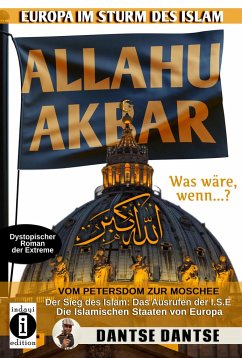Hundert Jahre Zärtlichkeit
Surrealismus, Bürgertum, Revolution

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Im politisch so umkämpften wie ereignisreichen 20. Jahrhundert kommt dem Surrealismus, wie ihn André Breton 1924 in seinem Ersten Surrealistischen Manifest entwarf, eine Sonderstellung zu: Obwohl er heute selten anders denn als künstlerische Avantgarde rezipiert und erzählt wird, handelte es sich tatsächlich um eine bürgerliche Aufbruchsbewegung, die das Bürgertum selbst vor seine Widersprüche zu stellen versuchte. In Romanen, Aufsätzen und Gedichten konzipierten die Surrealisten eine Politik der minimalen Ansprüche, die das Bürgertum an sich selbst zwingend stellen soll: falls das ...
Im politisch so umkämpften wie ereignisreichen 20. Jahrhundert kommt dem Surrealismus, wie ihn André Breton 1924 in seinem Ersten Surrealistischen Manifest entwarf, eine Sonderstellung zu: Obwohl er heute selten anders denn als künstlerische Avantgarde rezipiert und erzählt wird, handelte es sich tatsächlich um eine bürgerliche Aufbruchsbewegung, die das Bürgertum selbst vor seine Widersprüche zu stellen versuchte. In Romanen, Aufsätzen und Gedichten konzipierten die Surrealisten eine Politik der minimalen Ansprüche, die das Bürgertum an sich selbst zwingend stellen soll: falls das Bürgertum diesen minimalen Redlichkeits- und Folgerichtigkeitsansprüchen nicht gerecht werden sollte, so gehörte es abgeschafft. In beiden Fällen würden sich nämlich die Werte von Freiheit, Gleichheit und Solidarität realisieren, indem bürgerliche Privilegien aufgegeben und gemeinsame Werte erkämpft werden könnten. Hundert Jahre nach seiner Ausrufung ist der Surrealismus brandaktuell für unsere krisengebeutelte Gegenwart, in der die bürgerliche Klasse nicht nur verkennt, dass sie kaum noch gemeinsame Klasseninteressen hat, sondern auch angesichts steigender Ungleichheit ganz und gar historisch gelähmt ist. Der radikale Freiheitsbegriff, der sich aus dem surrealistischen Programm ergibt, erlaubt uns heute, eine Politik der Möglichkeiten angesichts apokalyptischer Aussichten zu denken - wenn wir den Surrealismus nicht nur feiernd historisieren, sondern erneut als konkreten Ausgangspunkt politischer Bewegungen begreifen. Doch dies ist schließlich ein Buch über einen historischen Präzedenzfall: bürgerliche Revolten gegen das Bürgertum sind immer auch Enthemmungsmomente, deren Preis die Gesellschaft unter Umständen schließlich zahlen muss.