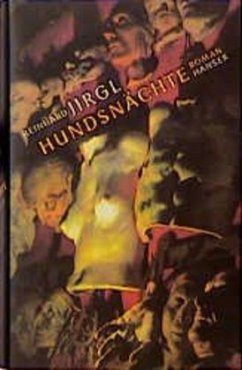Deutschland Mitte der neunziger Jahre. Im Grenzgebiet zur ehemaligen DDR liegen die Ruinen eines längst verlassenen Dorfes, die jetzt beseitigt werden sollen. Zu diesem Zweck rückt eine Abrisskolonne an, der auch ein ehemaliger Ingenieur angehört. Vor Ort erfahren die Männer, dass in dem Dorf noch jemand haust. Ein Mann, der seit langem nicht mehr ansprechbar ist, aber ununterbrochen schreibt. Eine Nacht soll ihm noch verbleiben, dann muss auch er verschwinden. Der Ingenieur, selbst ein Einzelgänger und Außenseiter, begibt sich für diese eine Nacht zu dem Mann in die Ruine und versucht, ihn zum Auszug zu bewegen.
Jirgl beschreibt den Lebenskampf in einer neuen Epoche als einen Kampf um die Erinnerung, gegen Stummheit, gegen Hass, Kälte und Lieblosigkeit. Ein großer Roman über die jüngste deutsche Geschichte.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Jirgl beschreibt den Lebenskampf in einer neuen Epoche als einen Kampf um die Erinnerung, gegen Stummheit, gegen Hass, Kälte und Lieblosigkeit. Ein großer Roman über die jüngste deutsche Geschichte.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Es ist nicht jeder frei, der seiner Ketten spottet: Reinhard Jirgls Roman "Hundsnächte" / Von Lothar Müller
Im neuen Roman von Reinhard Jirgl fällt in einem Wohnzimmer der Blick durch die schimmernde Glasscheibe einer Büchervitrine. Er trifft auf die "Buchrücken von Exemplaren, die seinerzeit im-Osten jeder, der mittels Büchern fliehen u entkommen wollte, durch jene seltsamen Winkel-& Küngelzüge seiner Beziehungen zu Buchhändlern, sich zu ergattern wußte". Die Lesergeschichte der DDR, von der hier die Rede ist, gibt es erst in Bruchstücken. Eines davon stammt von dem Lyriker Durs Grünbein. Er hat beschrieben, wie er Anfang der achtziger Jahre bei der Lektüre eines aus dem Westen stammenden Taschenbuchexemplars von Elias Canettis "Masse und Macht" in den anthropologischen und ethnologischen Beschreibungen ferner Stämme und Völker immer wieder Urszenen der eigenen Gesellschaft wiedererkannte.
Reinhard Jirgl, geboren im Jahre 1953 in Ost-Berlin und knapp zehn Jahre älter als Grünbein, hat seit Mitte der siebziger Jahre geschrieben, aber nichts veröffentlicht, solange die DDR bestand. Nach dem Fall der Mauer erschienen seine Bücher Schlag auf Schlag, und es war ihnen unschwer anzusehen, wieviel sie der als innere Ausreise betriebenen Lektüre verdankten. Kunze, Plenzdorf, Biermann oder Volker Braun spielten darin keine Rolle, wohl aber die groben und die feinen Denker der Masse und der Macht: Oswald Spengler, Ortega y Gasset und Michel Foucault. Jirgls "Schichtungsroman" mit dem Strindberg-Titel "Im offenen Meer" (1991) enthielt zahlreiche Prosaminiaturen, in denen Ernst Jüngers "Abenteuerliches Herz", Arno Schmidts "Leviathan" und immer wieder Gottfried Benns Geologie und Biologie des Ich zu schwarzen Spiegeln der DDR wurden. Höhnisch wie Benn, der den Chimären des Idealismus die Eingeweide der Leichen, dem Geist das sezierte Gehirn und der Seele das unter dem Skalpell des Pathologen zuckende Fleisch entgegenhielt, schilderte Jirgl die "entwickelte sozialistische Gesellschaft" als eine einzige große Krebsbaracke. Die Lust, mit der er gegen die Aufbau- und Fortschrittsrhetorik die Logik der Wiederkehr des Gleichen mobilisierte, muß in den Zeiten, als er für die Schublade schrieb, seine Rache an der eigenen Zukunftslosigkeit gewesen sein.
Sein Roman "Abschied von den Feinden" (1995) war ein großer, haßerfüllter Abgesang auf die DDR, eine Verfluchung ihres Weitervegetierens und Nichtsterbenkönnens. Stimmenimitator war Jirgl auch in diesem Buch, zugleich aber gewann er seinem Haß einen eigenen Ton und eine eigene Bilderwelt ab. Kaum ein Leser wird die Schilderung eines Flächenbrandes nahe den Grenzanlagen vergessen, bei dem eine Koppel Pferde in Panik auf den Stacheldrahtverhau zugaloppiert und ein Tier von den Selbstschußanlagen nach und nach zerfetzt wird. Nicht aus den Figuren oder gar aus der ins Allegorische hinüberspielenden Handlung gewann der Roman seine innere Einheit, sondern allein aus der unangefochtenen Herrschaft des bösen Blicks. Alle sprachlichen Mittel, die Jirgl nicht ohne Anstrengung aufbot, dienten der Rückverwandlung des untergegangenen souveränen Staates DDR in eine "Zone" des Todes. Dies nicht im Sinne weltpolitischer Sektorengrenzen als "Ostzone", sondern nach dem Modell sterbender Natur als Zone des "Verschwindens" und der "Verwesung". Die Mauerspechte der Jahre 1989/90 hatten den Schutzwall dieser Zone in handliche Ruinensplitter, manche von ihnen klein wie Nuggets, verwandelt. Spätestens seit der Stalinallee waren das Bauen und Aufbauen zu Zentralmetaphern der DDR-Phraseologie geworden.
Jirgls Roman der DDR als "Zone" irgendwo zwischen Tarkowskijs "Stalker" und David Lynchs "Eraserhead" gewann demgegenüber seine grauenhaften, widerlichen Züge vor allem daraus, daß er in der Apotheose des Zerfalls das Register wechselte. An die Stelle des Anorganisch-Steinernen, das in sich zusammenfällt oder zerbröckelt, setzte er die Selbstauflösung des Pflanzenhaften, des Organisch-Vegetativen, das in Fäulnis und Gestank vergeht. Seine "Zone" war längst nicht mehr Gegenstand politischer Analyse und Kritik, sondern nur noch eine Sphäre des Abscheus und des Ekels, die statt Hammer und Sichel das leitmotivisch wiederkehrende Aas und die Fliegen, die es umschwärmen, im Wappen trug.
In seinem neuen Roman hat Jirgl dort weitergeschrieben, wo er in "Abschied von den Feinden" aufgehört hatte: im ehemaligen Grenzgebiet, in einem Dorf, das schon zu DDR-Zeiten zwangsevakuiert worden und dem Verfall preisgegeben war. Hier läßt er nun - "im siebten = dem Bösen Jahr der Ehe mit einer Leiche" - eine Abrißkolonne antreten, die mit Bulldozern und Planierraupen die schon halb in die Pflanzenwelt zurückgesunkenen Restgemäuer endgültig abräumen soll. Dort, wo einst der Todesstreifen war, soll ein Radweg angelegt werden: "von Lübeck bis runter nach Hof. Und das - Ganze heißt dann auch noch Lebensstreifen.!" Jirgl hat seinen Roman als exakte Umkehr dieses idyllischen Projekts angelegt: Statt die Überreste der DDR im Freizeitpark des allerneuesten Deutschland aufgehen zu lassen, holt er den Westen in jene "Zone" des toten Lebens hinein, als die er die DDR immer schon beschrieben hat. Das Abrißkommando, das zum besseren Verständnis auch "Fremdenlegion" heißt, wird aufgehalten: Eine der Figuren aus "Abschied von den Feinden" vegetiert noch als "Toter, der nicht sterben kann", in den Ruinen. In den Hohlraum der nächtlichen Frist, die bis zur Räumung noch bleibt, zitiert Jirgl sein angestammtes Personal aus Untoten hinein. Und dann erhöht er, wie der Titel "Hundsnächte" anzeigt, den Wärmegrad, um den Prozeß der Verwesung zu beschleunigen. Zu den Hitzewellen jeder Hundstage gehören die Hundstagsfliegen, von denen der Volksmund spricht. Sie umschwirren den nach der Wende deklassierten Ingenieur, der in der "Fremdenlegion" Dienst tut und sich dem Ruinenbewohner zugesellt, um ihn vor dem Planiertwerden zu bewahren; sie umschwirren die Frau eines Selbstmörders, der an seiner Aufsässigkeit gegenüber dubiosen Geschäften der DDR zugrunde ging, die als Hure in Berlin arbeitet; sie umschwirren den "Feisten", der als zynisch-lebendige Leiche der Stasi die wenigen Handlungsfäden in diesem Buch zieht.
Der erste Paragraph im Grundgesetz der Jirgl-Welt lautet: Niemand kann der Zone entkommen. Er trägt den Zusatz: Dies gilt auch für Ausreisende. In der Diktion des Romans liest sich das so: "auch Sie, Lieberfroint & Wurzellos im Westen, auch Sie bleiben 1 Zoni auf Lebenszeit." Die Wende war für Jirgl keine Zäsur. Sie war lediglich eine "Zeichenwende": die Modernisierung der "Zone" unter den Spruchbändern einer neuen Aufbaurhetorik, das Aufschminken einer Leiche mit westlicher Kosmetik. Dem Ausfall gegen die innere Opposition der DDR, den er dem ehemaligen Stasi-Agenten in den Mund legt, steht der Roman insgesamt nicht allzu fern: "Wohnstube Rotwein & Quatschquatschquatsch von der-Besserenwelt bis euch 1 abging - : ihr Hilfsschüler, Sitzenbleiber, Hallelujaklampfer & zugelallten Medea-Spinner: Nicht trotz sondern !wegen euch gabs & gibts solche Typen wie mich". Die einzigen Helden, die Jirgls Roman als solche gelten läßt, sind die Renitenten, die Arbeitsverweigerer und jene Störenfriede, die nicht eines Flugblattes wegen, sondern als "Rowdys" in Bautzen landeten. Ihr Loblied läßt er wiederum von der Stasi singen: "Typen wegschaffen, nach denen kein Hahn & kein Politmagazin krähte, aber! die waren wirklich gefährlich für uns, waren die tiefen Risse im Fundament".
Wieder steht Jirgl im Wettstreit mit der bildenden Kunst, mit Goya, Francis Bacon und den sich wie im Angstschauer zusammenziehenden Häuserwänden des Expressionismus. Wieder gelingen ihm beklemmende Darstellungen der Ausweglosigkeit: Einer erinnert sich zwanghaft daran, wie er als Kind mit seinem Fahrrad eine schwerverletzte Taube noch einmal überfuhr, die die Räder eines Armeelastwagens zurückgelassen hatten; das Eingeschlossensein in der Ruine ist überblendet mit der Heraufkunft von Bildern eines Schuljungen, der im Kabuff des Schulgebäudes seiner herannahenden Entdeckung und Bestrafung harrt.
Doch ist der Roman insgesamt zugleich das Dokument einer Gefahr, in der sein Autor schwebt: die Balance zwischen dem Gesehenen und den Kopfgeburten zu verlieren. Ein unscheinbares Indiz dieser Gefahr ist die Länge dieses Buches; es hat zweihundert Seiten mehr als sein Vorgänger, ohne ihm doch substantiell Neues hinzuzufügen. "Ekel und Abscheu nähren sich von jedem Stoff." Mit diesem Grundsatz häuft und steigert Jirgl, was stets schon im Zentrum seiner Poetik der Verwesung stand. Er treibt die Auslöschung aller Illusionen der Liebe durch die Bilder von Sperma, Schweiß und Schleim über das Exerzitium der Monotonie hinaus bis in die Regionen der Kinderschändung. Ging noch im "Abschied von den Feinden" der Rückgriff auf die barock-katholischen gemarterten Körper wie von ungefähr aus dem Kirchgang katholischer Flüchtlinge aus dem Sudetenland hervor, so inszeniert er nun den Tod des allegorischen Stasi-"Feisten" als blutige Kreuzigungsszene im auftrumpfenden Format der Historienmalerei von einst. Um so mehr fällt auf, wie wenig Jirgl vom gegenwärtigen Berlin sieht. Er läßt eine der Figuren im Regen durch die Stadt treiben und klammert sich dabei an Rimbauds "Trunkenes Schiff". En passant schimpft er auf die Touristen am Prenzlauer Berg und deutet einige verfallende Mietshäuser oder "heiße Abrisse" an - das aktuelle Gemisch aus Alt und Neu gerät ihm nur schemenhaft in den Blick. Wie mit der Klischeemaschine heruntergespult wirken stellenweise die Hohnbilder der dumpf vor RTL und Sat 1 vegetierenden Massen und der ewig unbefriedigten Hausfrauen. Dieser Roman hat einen geringeren Verdichtungsgrad als sein Vorgänger.
Hier schreibt einer, der sich seiner Mittel gewiß ist. Zu ihnen gehören die Regeln einer selbstgemachten Orthographie und Interpunktion: "-! Keiner betritt noch 1 Mal diese Ruine." Die Obsession, der Jirgl in seiner pedantisch durchkonstruierten privatsprachlichen Ordnung folgt, dürfte mehr sein als nur ein Modernitätssignal oder eine Reverenz an Arno Schmidt. An ihrem Ursprung darf man den unbändigen Wunsch suchen, sich in Rivalität mit der Sprache der DDR zu einem absoluten Souverän im Reich der Schrift aufzuschwingen. Jirgls Abkürzungen, Chiffren und "Leids-Ordner" sind ein Zerrspiegel der bürokratischen Wucherungen in der verblassenden DDR-Phraseologie. Sie brachte ja nicht nur den alltäglichen Surrealismus der "Fischfrikadelle Sigmund Jähn" und des "Schnitzels Völkerfreundschaft" hervor, über die die Transitreisenden lächelten. Es gab auch die Kürzelungeheuer vom Schlage des "OdF"-Platzes, mit dem die Opfer des Faschismus geehrt werden sollten. Mit dem Untergang der DDR ist Jirgl ein Echoraum abhanden gekommen, über dessen Fehlen die enzyklopädische Wut, mit der er vom "Sünden-Phall" zum "hypocritical korrekten ?Betroffenheits-Kockteil" eilt, nicht hinwegtäuschen kann. Die Ausbeute an Klangspielen und finsteren Kalauern ist beträchtlich. Unübersehbar aber zugleich das drohende Verschwinden in der schlechten Unendlichkeit des Virtuosen, der gnadenlos alles macht, was er kann.
Die Literaturkritik hat Jirgl gelegentlich als expressionistischen Tragiker und Weltverfinsterer gegen seine ironisch-gutgelaunten Kollegen im Westen ausgespielt. Es ist aber fraglich, ob ihm einen Gefallen tut, wer seiner Einkapselung in das selbstgeschaffene Universum applaudiert. Sein neues Buch handelt nicht nur vom Ekel. Es hat die Unfreiheit gegenüber dem Gegenstand, die jedem Ekel innewohnt, als selbstzerstörerische Kraft in sich aufgenommen. So fehlt in den "Hundsnächten" dem allgegenwärtigen Brechreiz der Widerstand seines feindlichen Bruders: des unwiderstehlichen, befreienden Gelächters.
Reinhard Jirgl: "Hundsnächte". Roman. Hanser Verlag, München 1997. 522 S., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Dies ist große Literatur, widerspenstig und ein gewaltiger Rammbock in den gegenwärtigen Moden des Schreibens und seiner Rezeption." Helmut Böttiger in der 'Frankfurter Rundschau'
"Jirgl hat einen atemberaubenden poetischen Entwurf gewagt, er hat das Bild einer Gesellschaft, die im gleichen Maße dümmer wird, wie sie Wissen ansammelt, die einen scheinbar unerschöpflichen Vorrat an Infantilität bereithält, bis zur Kenntlichkeit verzerrt." Peter Walther in der 'tageszeitung'
"Anders als die Welt, die er beschreibt, hat dieser Roman aber mehr als eine Seite, genau gesagt hat er eine lyrische, schlüsselhaft schöne Seite und fünfhundertzehn erschreckende, widerliche, ekelerregende, großartige und meisterhafte, deren Sprachkraft und Imagination allein dastehen in der heutigen deutschen Literatur." Philipp Blom in der 'Berliner Zeitung'
"Vielleicht ... ist Jirgls atemloses, vital aufzuckendes Erzählen, diese manische Arbeit am Differenzierungsvermögen von Sprache, dieser Überbietungsgestus gegenüber seinen literarischen Vätern, nichts als ein absurdes Auflehnen aus heroischer Verzweiflung, wenn nicht aus Zwang, ein panisches Anhäufen von Geschichten und ihren Stoffen ge-gen diesen stets präsenten Sog ins Nichts. Vielleicht ist es auch umgekehrt und der Widerstand eine Preisgabe - euphorisch und nicht minder absurd." Hamburger Rundschau
"Wer die zynischen Steigerungen des Alptraums aushält, wird durch die artifiziellen Raffinessen der Klang- und Bildermaschine reich belohnt." Elisabeth Strehlau in der 'Welt'
"Jirgl hat einen atemberaubenden poetischen Entwurf gewagt, er hat das Bild einer Gesellschaft, die im gleichen Maße dümmer wird, wie sie Wissen ansammelt, die einen scheinbar unerschöpflichen Vorrat an Infantilität bereithält, bis zur Kenntlichkeit verzerrt." Peter Walther in der 'tageszeitung'
"Anders als die Welt, die er beschreibt, hat dieser Roman aber mehr als eine Seite, genau gesagt hat er eine lyrische, schlüsselhaft schöne Seite und fünfhundertzehn erschreckende, widerliche, ekelerregende, großartige und meisterhafte, deren Sprachkraft und Imagination allein dastehen in der heutigen deutschen Literatur." Philipp Blom in der 'Berliner Zeitung'
"Vielleicht ... ist Jirgls atemloses, vital aufzuckendes Erzählen, diese manische Arbeit am Differenzierungsvermögen von Sprache, dieser Überbietungsgestus gegenüber seinen literarischen Vätern, nichts als ein absurdes Auflehnen aus heroischer Verzweiflung, wenn nicht aus Zwang, ein panisches Anhäufen von Geschichten und ihren Stoffen ge-gen diesen stets präsenten Sog ins Nichts. Vielleicht ist es auch umgekehrt und der Widerstand eine Preisgabe - euphorisch und nicht minder absurd." Hamburger Rundschau
"Wer die zynischen Steigerungen des Alptraums aushält, wird durch die artifiziellen Raffinessen der Klang- und Bildermaschine reich belohnt." Elisabeth Strehlau in der 'Welt'