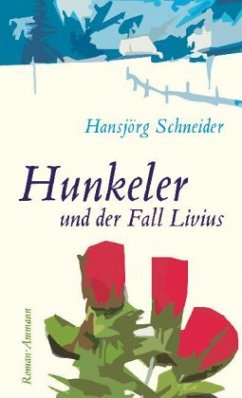In seinem sechsten Fall wird der Basler Kriminalkommissär Peter Hunkeler mit einem Mord konfrontiert, der länderübergreifend zu einer sensiblen Sache nicht nur für die Ermittlungsbehörden, sondern auch für Historiker wird. In einer Schrebergartenanlage am Stadtrand von Basel, deren Boden auf französischem Hoheitsgebiet liegt, wird am Neujahrsmorgen eine männliche Leiche gefunden. Der Tote wurde erschossen, man fand ihn jedoch aufgehängt an einem Fleischerhaken am First seines Gartenhäuschens, so, wie Schlachter die Kadaver ihrer toten Tiere aufhängen. Die Basler Polizei kann vor Ort nicht ermitteln, dafür ist die französische Kriminalpolizei vom elsässischen Colmar zuständig. Bald stellt sich heraus, wer der Tote ist. Er ist Schweizer, wohnhaft in Basel, doch handelt es sich auch tatsächlich um den ermittelten Anton Flückiger? Spuren führen ins Elsaß, aber auch in die behäbige Landschaft des bernischen Emmentals, und unvermittelt tauchen Ereignisse aus den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs auf, dessen Wunden im Elsaß nicht verheilt sind...
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Bestens unterhalten hat sich Beatrice Eichmann-Leutenegger bei der Lektüre von Hansjörg Schneiders Kriminalroman "Hunkeler und der Fall Livius". Diesmal muss der brummige Kriminalkommissär Peter Hunkeler einen Mord aufklären, der sich in einer idyllischen Schrebergartenanlage am Stadtrand von Basel ereignet hat. Die Spuren führen in die dunkle Vergangenheit des Besitzers der Anlage und in die letzten Wochen des zweiten Weltkriegs. Eichmann-Leutenegger sieht Schneider hier eine Tragödie behandeln, die aus dem Gedächtnis der Angehörigen verdrängt worden sei. Wie Schneider Verdachtsmomente in verschiedene Richtungen ausstreut und die Spannung bedächtig steigert, findet sie überaus gekonnt. In diesem Zusammenhang spricht sie von einer "nervenschonenden Behäbigkeit", die von Hunkeler-Fans sehr geschätzt würde.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH