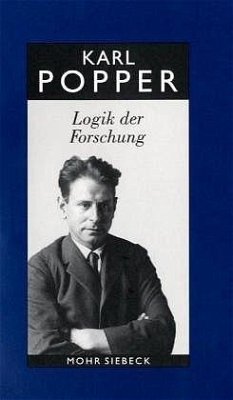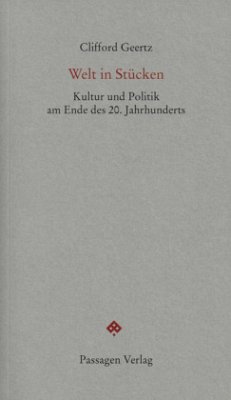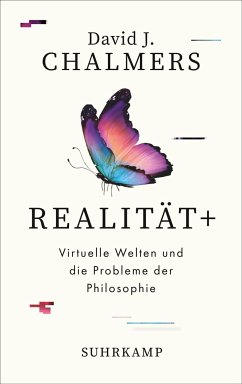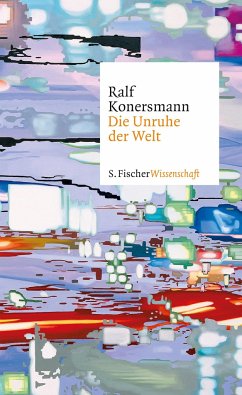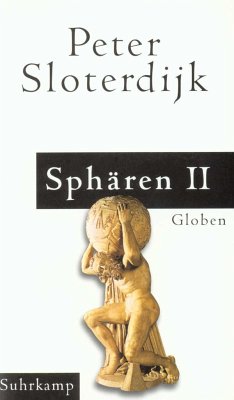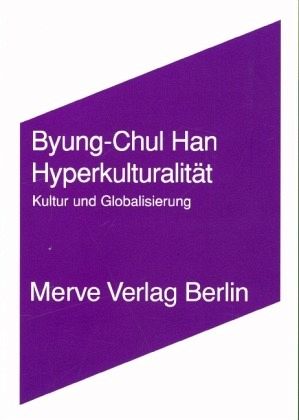
Hyperkulturalität
Kultur und Globalisierung
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
9,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Veränderungen, die der kulturelle Globalisierungsprozess bewirkt, erfordern einen neuen Kulturbegriff. Zunehmend lösen sich die kulturellen Ausdrucksformen von ihrem ursprünglichen Ort und zirkulieren in einem globalen Hyperraum der Kultur. Die Kultur wird zu einer Hyperkultur ent-ortet und entgrenzt.Hyperkulturalität reflektiert die Verfassung des heutigen In-der-Weltseins. Anhand einer Analyse von Phänomenen wie Ort, Weg, Schwelle,Fremdheit, Vernetzung, Aneignung und Identität wird gezeigt, inwiefern ein ganz anderes Sich-Orientieren in der Welt notwendig und möglich ist. --Themen...
Die Veränderungen, die der kulturelle Globalisierungsprozess bewirkt, erfordern einen neuen Kulturbegriff. Zunehmend lösen sich die kulturellen Ausdrucksformen von ihrem ursprünglichen Ort und zirkulieren in einem globalen Hyperraum der Kultur. Die Kultur wird zu einer Hyperkultur ent-ortet und entgrenzt.Hyperkulturalität reflektiert die Verfassung des heutigen In-der-Weltseins. Anhand einer Analyse von Phänomenen wie Ort, Weg, Schwelle,Fremdheit, Vernetzung, Aneignung und Identität wird gezeigt, inwiefern ein ganz anderes Sich-Orientieren in der Welt notwendig und möglich ist. --Themen:Tourist im Hawaiihemd - Kultur als Heimat Hypertext und Hyperkultur - Eros der Vernetzung - Fusion Food - Hybridkultur - Hyphenisierung der Kultur - Zeitalter der Vergleichung - Entauratisierung der Kultur - Pilger und Tourist - Windows und Monaden - Odradek - Hyperkulturelle Identität - Inter-, Multi- und Transkulturalität - Aneignung - Zum langen Frieden - Kultur der Freundlichkeit - Hyperlog - Wanderer - Schwelle