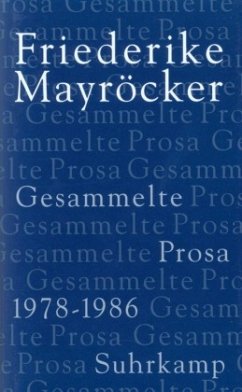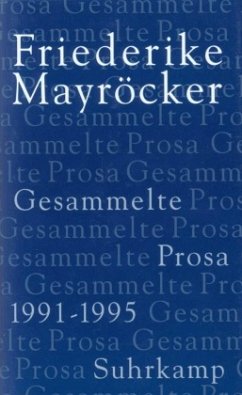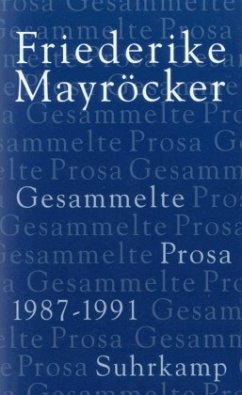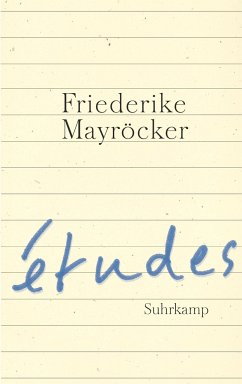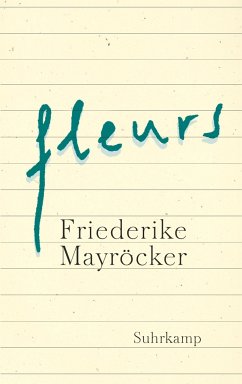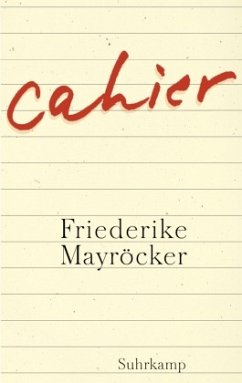ich bin in der Anstalt
Fusznoten zu einem nichtgeschriebenen Werk. Ausgezeichnet mit dem Bremer Literaturpreis 2011

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"ich bin in der Anstalt" nennt Friederike Mayröcker, die "Grande Dame der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur" (Süddeutsche Zeitung), ihre neue Prosaschrift - ein Buch der Betrachtungen von Körperlichkeit und Körperempfinden, ein Tasten nach den ständig sich verschiebenden Grenzen von Innen und Außen, ein Versuch ihrer Auflösung im Moment des Schreibens, radikal und schonungslos.