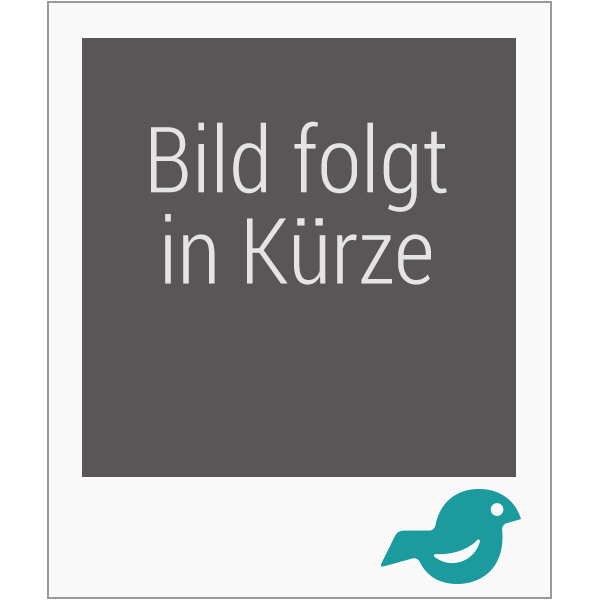Produktdetails
- Verlag: Edition Atelier
- ISBN-13: 9783902498519
- ISBN-10: 390249851X
- Artikelnr.: 33574314
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Begeistert hat Rezensentin Ingeborg Waldinger diesen nun unter dem Titel "ich die eule von wien" erschienenen Band mit Gedichten, Manifesten und Tagebüchern des Wiener Dichters Walter Buchebner gelesen. Die Kritikerin erlebt hier das gesamt Oeuvre Buchebners, der, aus proletarischen Verhältnissen kommend, zunächst wie sein Vater im Stahlwerk arbeitete und Arbeiterlyrik verfasste, sich bald als Leiter der Städtischen Bücherei in Wien an Vorbildern wie Paul Valery, Lorca und Pound orientierte und schließlich die mit Sprache und Drogen experimentierende Beat-Generation für sich entdeckte. Insbesondere lobt Waldinger aber das Spätwerk des Lyrikers, der sich im Jahre 1964 das Leben nahm: Inspiriert durch einen Parisbesuch, der ihn mit der Lyrik Baudelaires, Rimbauds und Apollinaires vertraut machte, habe sich Buchebner stilistisch befreit und "intuitive", von Leichtigkeit und Leid getragene Verse verfasst, berichtet die Rezensentin, der auch die hier abgedruckten späten Malereien des Dichters gefallen haben.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Gewissheiten für einen Wimpernschlag: Walter Buchebners Lebens war von seinem Willen zur Kunst genauso geprägt wie von seiner Krankheit. Davon zeugen seine Tagebücher und Gedichte.
Gebührt Walter Buchebner ein Denkmal? Und sei's auch nur aus Papier? Im steiermärkischen Mürzzuschlag, wo er 1929 geboren wurde, erinnern immerhin eine Walter-Buchebner-Gesellschaft und das von ihr initiierte rege "Kunsthaus Muerz" an diesen Dichter, der sich 1964, erschöpft von selbstquälerischen Zweifeln und von unerträglichen körperlichen Schmerzen, selbst tötete; in Paris übrigens, seiner Sehnsuchtsstadt. Zu seinen Lebzeiten ist kein einziges Buch dieses Dichters erschienen. Erst postum (1969) gab sein Freund und Dichterkollege Alois Vogel den noch von Buchebner selbst vorbereiteten Gedichtband "zeit aus zellulose" sowie weitere Gedichte und Tagebuchauszüge unter dem Titel "die weiße wildnis" (1974) heraus.
Nun also ein neuer Versuch, Walter Buchebner einen Platz im Gedächtnis der Leser zu verschaffen. Das kann nur gelingen, wenn ein Interesse an dem Autor geweckt wird, das über die Anteilnahme an seinem leidvollen Leben und sogar über die Anerkennung der literarischen Qualität seiner Werke hinausgeht. Es ist die Zugehörigkeit zu der geschundenen Generation der Nachkriegszeit, die Buchebner teils ganz naiv und teils höchst reflektiert artikuliert. Diese Generation der in den späten zwanziger und frühen dreißiger Jahre Geborenen, die nach dem Krieg befreit und doch zutiefst verletzt war - diese im Rausch des Wirtschaftswunders und in der Lethargie der Restauration schnell vergessene Generation repräsentiert Buchebner auf geradezu typische Weise.
Drei Themen bestimmen die Gedichte und Tagebuchaufzeichnungen dieses Bandes: Zunächst äußert sich hier der Wille zur künstlerischen Produktivität, zur "Poesie" anstelle von "Literatur": "Die Literatur ist tot! - Es lebe die Poesie!" Das Vorhaben, Kunst hervorzubringen, der Kult des Schaffens, das Programm und Ziel der künstlerischen Arbeit - all das hat Vorrang vor dem fertigen Produkt: "Unsterbliches schaffen (...) heißt, einen Schaffensprozeß vollziehen, der für alle Zeit, solange es Leben gibt, derselbe ist, einen unsterblichen Prozeß vollziehen."
Den zweiten Themenkomplex bildet Buchebners schroffe Kritik an den zeitgenössischen Erscheinungsformen des gesellschaftlichen Lebens, an der sich entwickelnden Wirtschaftswunderwelt in Österreich und in Deutschland. In Wien "stinken die verfaulten spitäler / die zu tod gewürgten politischen flirts / und durch die zeitungen geht / fetter selbstbetrug." Buchebner versteht sich, wie das Titelgedicht ("ich die eule von wien") zeigt, als Todesbote und als unbeachteter Beobachter dieser Scheinwelt: "ich niste in katakomben aus papier / und inhaliere die ekstasen von schlagern / vollbeschäftigung und korruption." Noch pauschaler fällt die Kritik an den "deutschen Brüdern" des verhassten, konsumbesessenen Adenauer-Staates aus: "dem Herrn sei Dank, der uns von Deutschland trennte!!!". Die "Active Poesie", die Buchebner als "Gegengift gegen die Kulturlosigkeit" entwirft, "muß wie ein brillant geschliffener Dolch die fettleibige Nichtigkeit durchstoßen, die wie ein Panzer Staat und Religion, als die Grundelemente des Daseins in soziologischer Gebundenheit, umgibt".
Das dritte Thema Buchebners ist die eigene Krankheit. Schon lange bevor er die ersten Anzeichen einer schweren Nierenerkrankung an sich beobachtete, die sich dann zunehmend als unerträglich und unheilbar erweisen sollte, sah er sich als Hiob-Existenz, und kurz vor seinem Ende heißt es in seinem Tagebuch immer noch: ",Hiobischer' als ich jetzt kann selbst der biblische Hiob nicht gewesen sein." Er verstand seine Krankheit als "Resultat der Zeitsituation in Wien, die mich in völlige Isolation zwingt".
Buchebner kombiniert diese drei Themenbereiche zu einem umfassenden Rebellionsprogramm, das existentiell, politisch und moralisch zugleich motiviert ist. Verzweifelt sucht er nach der ästhetisch angemessenen Form für dieses Programm, orientiert sich anfangs an dem "Meister" Hermann Hakel, dem autoritären Förderer der jungen Literaten in Wien (über den er bald darauf hemmungslos herfällt), studiert dann die Schriften des Existentialismus, probiert die Zugehörigkeit zur "lost generation" aus, schließt sich - als einer der ersten deutschsprachigen Schriftsteller überhaupt - den amerikanischen Beatniks, vor allem Allen Ginsberg und Jack Kerouac, an und entwirft, um die Poesie mit der populären Musik zu verbinden, eine "Theorie des Blues-Gedichtes". Das alles kann man in seinen Tagebüchern nachlesen, die er uneingeschränkt als sein "Hauptwerk" bezeichnet: "Es wäre sinnlos, meine kostbare Lebenszeit mit schlechten Dramen und unbrauchbaren Romanen, mit schon dagewesenen Gedichten und ähnlichem Unfug zu vertun."
Die Aufzeichnungsform des Tagebuchs kommt dem spontanen Temperament und der rauschhaften Formulierungslust Buchebners in der Tat sehr entgegen. Auch viele seiner Gedichte muten in diesem Sinne tagebuchartig an. Angesichts der Bedeutung dieser Tagebücher für den Autor überrascht es, dass sie offenbar nur in gekürzter Form präsentiert werden: In ihrem Nachwort zitiert Daniela Strigl mehrfach Tagebuchpassagen aus dem Nachlass Buchebners, die nicht in den Band übernommen wurden. Ganz weggelassen wurde überdies Buchebners erzählerische Prosa, weil es ihr "an Originalität mangelt", wie die Herausgeberin unverhohlen mitteilt. Stattdessen bietet der Band eine Reihe von farbigen und schwarzweißen Bildern, die Buchebner in den letzten Monaten seines Lebens in Tusche und Öl geschaffen hat: Abstrakte titellose Gebilde, Eingebungen des Augenblicks: "Kunst ist nur einen Augenblick lang! So wie die Schöpfung. Jedes Bild, das ich male, ist nur im Augenblick des Entstehens. Leben ist nur, solange es aktiv sich äußert, verändert."
Nochmals also: Gebührt diesem Walter Buchebner ein Denkmal? Ihm, der sich als schnell verglühenden Meteor sah, der sich nach "wilden Ekstasen" sehnte, "daß ich darin aufgehe", ihm, dessen Orientierungslosigkeit sich hinter unerschütterlichen Gewissheiten verbarg, die nur im Augenblick ihrer Formulierung galten? Kein Denkmal gewiss dann, wenn man ihn auf diese Weise in die kanonische Literaturgeschichte einzufügen suchte; die sogenannte "Moderne" spielte sich woanders ab, beispielsweise in der Wiener Gruppe um H. C. Artmann, Gerhard Rühm und Konrad Bayer, die Buchebner nur als "verrückte Gruppe" wahrnehmen konnte. Wohl aber dann, wenn man die unausgegorene, aber unbedingte Kunstbemühung allein schon als denkmalwürdig anerkennen mag.
WULF SEGEBRECHT
Walter Buchebner: "ich die eule von wien". Gedichte, Prosa, Tagebücher.
Hrsg. von Daniela Strigl. Edition Atelier, Wien 2012. 336 S., Abb., br., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main