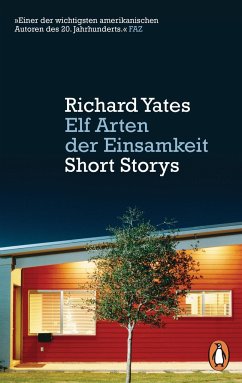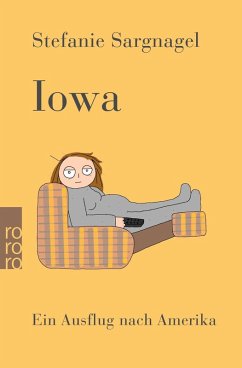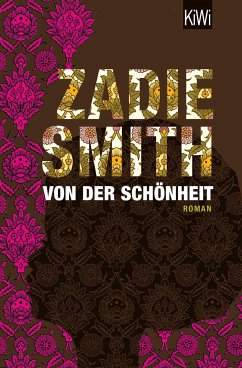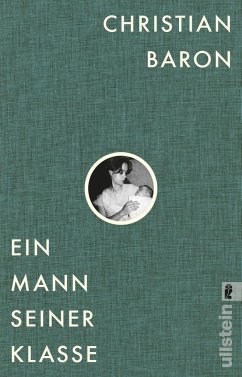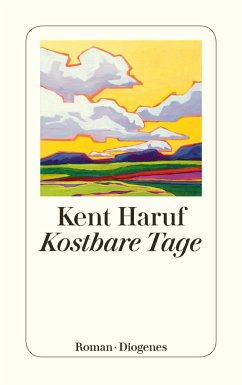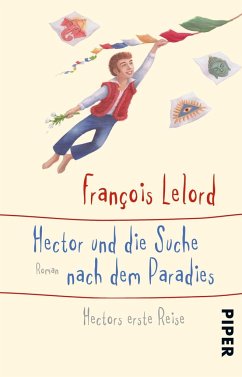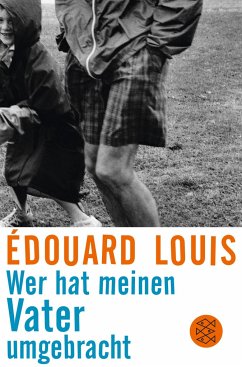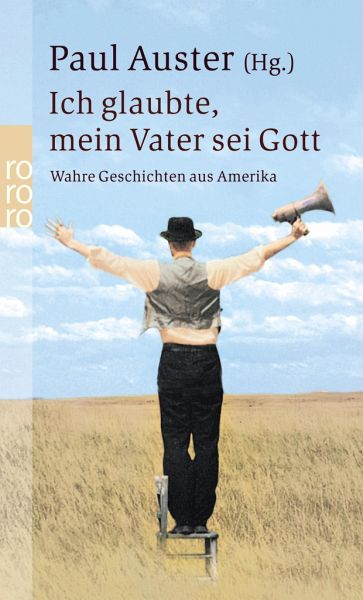
Ich glaubte, mein Vater sei Gott
Wahre Geschichten aus Amerika. Dtsch. v. Thomas Gunkel, Volker Oldenburg, Kathrin Razum u. a.
Herausgegeben: Auster, Paul;Übersetzung: Gunkel, Thomas; Oldenburg, Volker; Razum, Kathrin

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Paul Auster hat die Hörer des amerikanischen Public Radio gebeten, ihm Geschichten zu schicken. Ohne Themenvorgabe, nur kurz und wahr sollten sie sein. Das Echo war gewaltig. Knapp 200 der lustigsten, tragischsten, schauerlichsten und bewegendsten sind in diesem Band zu einem faszinierenden Ganzen gebündelt.