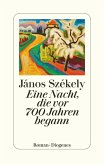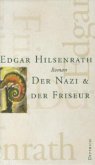An ihrem 85. Geburtstag bekommt Miriam Guldberg von ihrer Familie einen silbernen Armreif geschenkt, in den ihr Name eingraviert ist. Beim Anblick entfährt ihr der Satz: "Ich heiße nicht Miriam". Niemand in ihrer Familie kennt die Wahrheit über sie. Niemand in ihrer Familie ahnt etwas von ihren Wurzeln. Doch an diesem Tag lassen sich die Erinnerungen nicht länger zurückhalten, und sie erzählt zum ersten Mal von ihrem Leben als Roma unter den Nazis, im KZ und als vermeintliche Jüdin in Schweden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Matthias Hannemann ist nicht überzeugt von Majgull Axelssons Versuch, die Diskriminierung der Roma im Schweden der Nachkriegszeit in einen Roman zu fassen. Der zwischen Kriegs- und Nachkriegszeit und heute vermittelnde Text der Journalistin entrinnt nicht dem Gebrauch von Klischees und Filmkulissenhaftigkeit, wo laut Rezensent Fingerspitzengefühl angebracht wäre. Schäferhund und knallende Absätze in den Lagerbaracken, das scheint Hannemann nur schwer erträglich. Ebenso die wenig originelle Rahmenhandlung, in der eine alte Dame sich erinnernd ihr Geheimnis lüftet, und der betuliche Ton. Lieber greift der Rezensent zu einem Sachbuch zum Thema Roma in Schweden.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Majgull Axelssons Roman aus dem "Zigeunerlager"
Die schwedische Schriftstellerin Majgull Axelsson hegte gute Absichten, als sie sich mit dem Leiden und Sterben der Roma in deutschen Lagern auseinanderzusetzen begann. Sie besuchte Auschwitz-Birkenau, wo sich der Buchladen (wie sie schreibt) als "wahre Goldgrube" erwies, ließ sich Fürstenberg und Ravensbrück von Wissenschaftlern erklären, kontaktierte eine Überlebende, die bei Kriegsende in schwedische Flüchtlingsheime gelangt war, und da ein Teil ihres neuen Romans "Ich heiße nicht Miriam" im Schweden der Nachkriegszeit spielen sollte, besuchte Axelsson auch einen schwedischen Künstler mit Roma-Wurzeln und Orte wie Jönköping, wo es 1948 zu Ausschreitungen gegen Roma gekommen war.
Die Zustände, die in den deutschen "Zigeunerlagern" herrschten, seien, so hat es Zoni Weisz, der in der sogenannten "Zigeunernacht" 1944 seine Mutter, seine Schwestern und einen Bruder verlor, zum Holocaust-Gedenktag 2011 in einer Rede vor dem Bundestag betont, für immer "unvorstellbar". Die gelernte Journalistin Majgull Axelsson aber, die in den Achtzigern mit sozialkritischen Sachbüchern über Straßenkinder hervortrat und seit den Neunzigern solide Romane wie den Bestseller "Die Aprilhexe" oder den Familienthriller "Eis und Wasser, Wasser und Eis" publiziert hat, fühlte sich der enormen Herausforderung, die mit einem Roman über Holocaust und "Porajmos" verbunden ist, offensichtlich gewachsen.
Just dort, wo es bei einer Holocaust-Geschichte auf doppeltes Federspitzengefühl ankommt - bei der Schilderung des Horrors und Geschehens im Lager -, entkommt sie trotz aller Einfühlung aber nicht den Klischees: "Sie hört eine Aufseherin, die mit knallenden Absätzen zwischen den Zellen entlanggeht, zusammen mit ihrem Schäferhund, einem dieser unglaublich gehorsamen Wachhunde in Ravensbrück." Wir sehen eher Fernsehkulissen und Schauspieler vor uns als den Abgrund des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges.
Die Rahmenhandlung ihres betulich voranschreitenden Romans ist dabei nur bedingt originell: Eine Seniorin aus Nässjö kann ihren 85. Geburtstag nicht genießen - solche Tage sind nicht ihr Ding, und das silberne Armband, das ihr von der Familie geschenkt wird, ein von einem Roma-Schmied gebasteltes Schmuckstück, bekam eine Namensgravur, von der niemand ahnt, dass der Name so falsch ist wie Miriams angeblich jüdische Identität. Bald bricht es aus ihr da heraus: "Ich heiße nicht Miriam." Wobei es die Enkelin ist, der sich diese Frau detaillierter zu öffnen vermag.
Ein solcher Rahmen erlaubt es natürlich, Miriams (fiktive) Geschichte zu portionieren, die Autorin wechselt behende zwischen Erinnerung und Gegenwart, und bei den Nachkriegsszenen ist sie auch spürbar in ihrem Metier. Aber wenn man sich als Leser bereits nach wenigen Seiten zu wünschen beginnt, doch lieber nach einem Sachbuch über die Roma und Auschwitz oder Roma-Diskriminierung in Schweden zu suchen - einem Land, das dem "fahrenden Volk" bis 1954 die Einreise verbat -, geht Majgull Axelssons Rechnung wohl kaum so überzeugend auf wie gedacht.
MATTHIAS HANNEMANN.
Majgull Axelsson: "Ich heiße nicht Miriam".
Roman.
Aus dem Schwedischen von Christel Hildebrandt.
Ullstein Verlag, Berlin 2015. 576 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Dank des distanzierten, elegant gewundenen Schreibstils der schwedischen Autorin Majgull Axelsson gerät ihr Frauenschicksal aber nicht zum Holocaust-Kitsch, sondern wird zu einer spannennden Reflexion über erzwungene und selbst getroffene Entscheidungen. Münchner Merkur 20160416