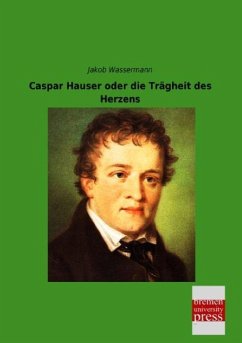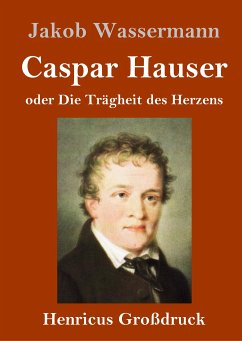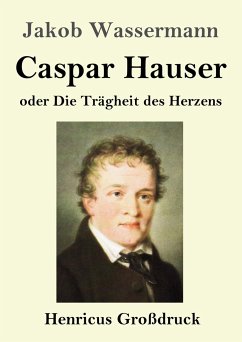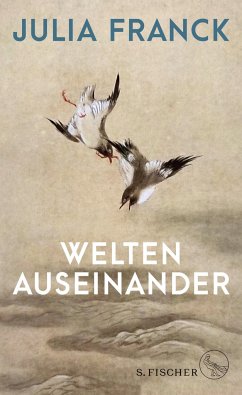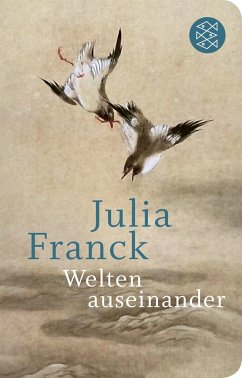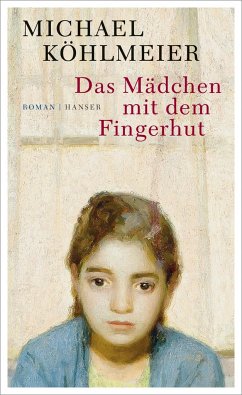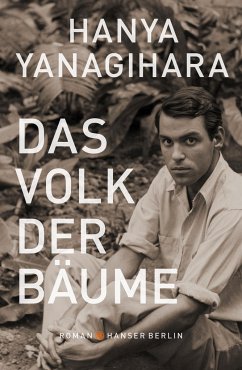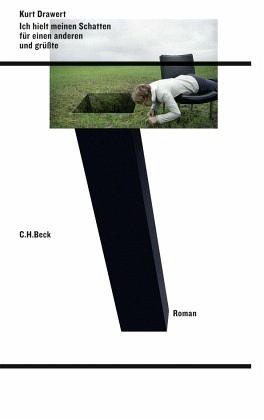
Ich hielt meinen Schatten für einen anderen und grüßte
Roman

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ich hielt meinen Schatten für einen anderen und grüßte ist der erste umfangreiche Roman des vor allem als Lyriker und Essayisten bekanntgewordenen Autors. In Anverwandlung an den spektakulären Kriminalfall des Kaspar Hauser im 19. Jahrhundert nimmt Kurt Drawerts Roman das Motiv des verwahrlosten Findlings auf, um vom Untergang der DDR und dem Übergang in eine neue Zeit zu erzählen. Dieser verunstaltete Kaspar der Revolution erinnert sich mit schonungsloser Sprachgewalt, so ernst wie komisch, so realistisch wie surreal, an sein Leben als bestürzende Höllenfahrt durch die neun Schuldbezi...
Ich hielt meinen Schatten für einen anderen und grüßte ist der erste umfangreiche Roman des vor allem als Lyriker und Essayisten bekanntgewordenen Autors. In Anverwandlung an den spektakulären Kriminalfall des Kaspar Hauser im 19. Jahrhundert nimmt Kurt Drawerts Roman das Motiv des verwahrlosten Findlings auf, um vom Untergang der DDR und dem Übergang in eine neue Zeit zu erzählen. Dieser verunstaltete Kaspar der Revolution erinnert sich mit schonungsloser Sprachgewalt, so ernst wie komisch, so realistisch wie surreal, an sein Leben als bestürzende Höllenfahrt durch die neun Schuldbezirke der Deutschen D. Republik . Er ist ein Zeuge jener Nichtwelt unter der Erde, in der sich die Proletarier aller Länder einst im Sumpf vereinigt haben. In seinen Merk- und Beobachtungsheften notiert dieser ostdeutsche Erdling die Zeit in der Zelle mit Holzpferd und Abfallkübel bis er Titelaufschreiber, Magazinläufer und Nachtwächter in der Nationalen Bücheranstalt wird, ehe er nach dem Ende der Höhlenrepublik an die Grenze zum feindlichen Ausland nach oben gelangt. Hier und da sahen wir noch Betonmauerreste, aus den Erdfugen gesprengte Stahlwände und Schachteinlässe, Zollbaracken und Kontrollpostentürme, aber alles nur noch in der eher albtraumhaften Verweisung darauf, einmal existiert zu haben, wie letzte, locker herumliegende Knochenrückstände, die an ein Schlachtfest erinnern. Seine phantasiereichen Erzählmonologe sind ein Antrag auf Anwesenheitsberechtigung in einem sich selbst unselbstverständlichen Dasein: Ich hielt meinen Schatten für einen anderen und grüßte. Kurt Drawerts Existenzbilder vom Verbrechen am Seelenleben des Menschen sind unabweislicher denn je und eine Metapher auf unsere moderne innere Obdachlosigkeit.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.