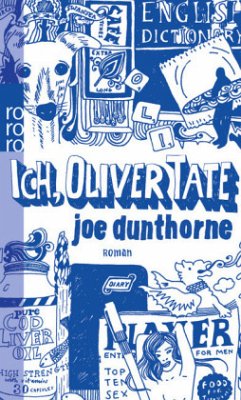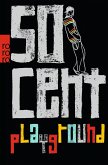"Dieses Buch wird mein Leben wohl nicht verändern. Aber wer weiß, was es mit Ihrem anstellt..." Oliver Tate
Oliver Tate ist fast fünfzehn und noch Jungfrau. Doch das soll sich ändern, am besten sofort. Seine Freundin hat allerdings andere Probleme. Eines davon: Oliver, der küsst, als wolle er Zahnfüllungen spachteln, der außerdem Fremdwörter sammelt und das Liebesleben seiner Eltern genauestens überwacht. Zwei Monate ohne Beischlaf, lautet der alarmierende Befund. Olivers dringlichste Mission: Die Ehe der Eltern neu beleben, jedes Mittel erlaubt!
"Das glänzende Debüt eines
geradezu grausam talentierten
jungen Komikers." The Times
-Oliver Tate
Oliver Tate ist fast fünfzehn und noch Jungfrau. Doch das soll sich ändern, am besten sofort. Seine Freundin hat allerdings andere Probleme. Eines davon: Oliver, der küsst, als wolle er Zahnfüllungen spachteln, der außerdem Fremdwörter sammelt und das Liebesleben seiner Eltern genauestens überwacht. Zwei Monate ohne Beischlaf, lautet der alarmierende Befund. Olivers dringlichste Mission: Die Ehe der Eltern neu beleben, jedes Mittel erlaubt!
"Das glänzende Debüt eines
geradezu grausam talentierten
jungen Komikers." The Times
-Oliver Tate