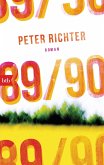Mit einer Einladung fängt alles an. Herr W. soll an einer Podiumsdiskussion unbekannter Untergrunddichter teilnehmen. Dumm nur, dass Herr W. sich überhaupt nicht erinnern kann, je schriftstellerisch tätig gewesen zu sein. Herr W. stellt Nachforschungen an und nimmt schließlich Einsicht in seine Stasi-Akte. Was für ein Fund: Tatsächlich sind hier seine lyrischen Gehversuche unter dem Titel "Mögliche Exekution des Konjunktivs" abgeheftet, dazu sämtliche Liebesbriefe an Liane in München ...

Das war die DDR: lethargisch, aber auch lustig, vorausgesetzt, man hatte selbst Humor. Rayk Wieland hat einen verblüffend leichthändigen Roman zum Wendejahr geschrieben.
Von Edo Reents
Kann man mit Büchern die Welt verändern?", fragte die "Titanic" im Herbst 1986. Zu sehen war Ronald Reagan, der "Yes, Sir!" antwortete und mit einer Schwarte auf den roten Knopf schlug, mit dem man die Atombomben zündete. Dass drei Jahre später mit dem ganzen Ostblock auch die DDR zu Bruch ging, muss aber nicht unbedingt kollektiver Lesewut zugeschrieben werden. Die Ursachenforschung für den Republik-Untergang hat seither gleichermaßen Erinnerungen und literarische Phantasien freigesetzt, die den einen immer noch zu wenig sind - irgendwie wartet man ja immer noch auf den Wenderoman -, den anderen schon zu viel oder aufdringlich, den wieder anderen zu larmoyant oder feierlich.
Einen unerhörten Ton schlägt nun Rayk Wieland an. Sein Roman "Ich schlage vor, dass wir uns küssen" signalisiert im Titel die frech-sympathische Unbekümmertheit mancher Schlager und hält sich ansonsten an den intelligenten, informierten Humorbegriff des "Titanic"-Umfelds, dem Wieland persönlich auch zuzurechnen ist. Dieser aus Leipzig stammende Autor und Journalist unterzieht das letzte DDR-Jahrzehnt einer Erinnerungsprozedur, die zu dem bräsigen, zuweilen auch wehleidigen Ernst sonstiger Vergangenheitsbewältigung denkbar weiten Abstand hält. Wenn man den Artikel noch im Kopf hat, den Wieland vor zwei Jahren in der Wochenendbeilage der "Süddeutschen Zeitung" geschrieben hat, dann muss man annehmen, dass die Geschichte des 1965 geborenen, in Ost-Berlin wohnenden W. im Kern wahr und selbst erlebt, weniger durchlitten ist: W. bekommt eines Tages eine Einladung zu einem Symposion "Dichter. Dramen. Diktatur. Nebenwirkungen und Risiken der Untergrundliteratur in der DDR". Offenbar hält man ihn, der als Schriftsteller bisher nicht hervorgetreten ist, für einen ehemals regimekritischen Autor. Und er erinnert sich: an Briefe, die er jahrelang einer in München lebenden Geliebten schrieb und die voll waren mit Liebesgedichten, die zeigen, dass er seinen Peter Hacks kennt. Die Stasi liest das aber ganz anders und wittert, in Gestalt des Oberleutnants Schnatz, noch in einer Shakespeare- oder Schiller-Anspielung einen Oppositionsgeist, der W. im Grunde abgeht. Wo die ihm attestierte Intelligenz kein Kompliment, sondern eine "Gefahrenbeschreibung" ist, da dient das Nichtwissen dem sozialen Frieden.
So wird, durch fehlgeleitete Schnüffelphilologie, aus warmherzigen, politisch irrelevanten Äußerungen eine einzige "tickende Lyrikbombe", auf deren Entschärfung man die Mühe verwendet, die andernorts womöglich mehr geholfen hätte: "Gut möglich, daß dieser Staat, der einen grotesk überschätzten Liedermacher mit Hängeschnauzer sogar ausbürgerte, am Ende durch die obsessive Konzentration seiner Spezialkräfte auf harmlose Hobby-Existentialisten wie mich völlig konfus wurde." Diese fast komödiantische Ausgangssituation erlaubt Wieland einen verblüffend spielerischen, aber nie verharmlosenden Umgang mit der aus heutiger Sicht nur noch schwer verständlichen Paranoia eines Landes, das buchstäblich von der Last seiner Stasiakten erdrückt wurde. Die Chiffre "Mauerbau", immer noch der DDR-Sündenfall, wird hier ins Harmlos-Kauzige gewendet: W. gründet die "Gruppe 61", die sich eine allgemeine Entschleunigung zur Aufgabe macht.
Die Zeitreise, auf die W. sich zurück-in-die-zukunft-haft begibt, gerät zu einer eigenen Reflexion über Erinnerungspolitik. Damit kriegt der Erzähler sein eigentliches Thema zu fassen, das eben auch ein genuin literarisches ist: Worauf kommt es an, wenn wir zurückdenken - auf den "Krempel" in Form von Fotos und Hausrat oder auf das, was die Menschen aus- und unvergesslich macht? "Dinge, die einfach verschwinden, einzelne Sätze, Gespräche, für immer gelöscht, komplette Nächte verschollen. Die Leute verlieren nicht nur Haare, sondern auch Namen und Gesicht. Es gibt Personengruppen von der Größe einer Kleinstadt, die niemals wiederauftauchen, für alle Zeit verduftete Augenblicke, Küsse, Schatten, Zahnschmerzen". Dies ist die einzige Stelle, an der Wieland sentimental wird. Fast könnte einem Goethe in den Sinn kommen: "So verrauschte Scherz und Kuß / Und die Treue so". Inmitten einer mit bemerkenswert leichter Hand geschriebenen, auf ihre Pointen hin kalauernd zurechtgeschnittenen Autobiographie stellt sich plötzlich die Frage nach der Haltbarkeit von Empfindungen.
Wieland lässt sie offen und beschreibt stattdessen ein Leben von angenehmer Normalität, das W. im Dunstkreis von Tagedieben und Gaunern führt, ein originell denkender, charmanter Taugenichts, der auf Reisen und anderen Luxus gut verzichten kann. Das akribische Erzählen ist seine Sache dabei weniger; das Verfahren hat eher etwas Nummernrevuehaftes und vermag aus der kalauerhaften Abwandlung abgestandener Redewendungen jene Funken zu schlagen, die bei handelsüblicher Erinnerungsarbeit selten abfallen: "Ich würde gern optimistischer in die Vergangenheit schauen, vor allem in die eigene." Irgendwann sucht W. die Kantine des Werks auf, wo er eine Elektrikerlehre absolvierte, und sieht ein altes Wandbild. Dieser "Altar" wird ihm nun zum Symbol einer mit sinnlosem Eifer durchstrukturierten Arbeitswelt, das jene "Dynamik der Lethargie", jene "eindrucksvolle Passion der Bitterkeit" zum Ausdruck bringt, die das DDR-Leben prägten innerhalb derer man aber durchaus seine Nischen finden konnte. Das Symposion, zu dem W. eingeladen wird, erweist sich als komplettes Missverständnis: W. will hier das "Lob der Mauer" singen und rechnet mit einer Mehrheitsmeinung ab, die mit dem Opferstatus Politik und manchen mundtot macht. Beim Mauerfall sieht man ihn, fast wie Franz Beckenbauer 1990 auf römischem Rasen, grübelnd abseits wandeln; der allgemeine Jubel ist ihm einfach zu würdelos.
Man muss leider befürchten, dass es Leser gibt, denen das zu frivol ist. Die DDR und die Ironie standen, auch das wird witzig entwickelt, nicht auf bestem Fuße miteinander. Vielleicht besteht wenigstens im Nachhinein Hoffnung. Sei es drum. Man muss mit Büchern nicht gleich die Welt verändern. Es ist schon viel gewonnen, wenn man damit die Tonlage eines Gedenkjahres zum Heiter-Unverkrampften hin ändert.
Rayk Wieland: "Ich schlage vor, dass wir uns küssen". Roman. Verlag Antje Kunstmann, München 2009. 210 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Entzückt zeigt sich Rezensentin Susanne Messmer von Rayk Wielands "wunderbar leichtem" DDR-Roman "Ich schlage vor, dass wir uns küssen". Gerade weil das Buch weder "nostalgisch oder moralisch noch monumental oder neunmalschlau" ist, sondern "leicht und lustig", hält sie es für einen der besten Romane über die DDR, die in den letzten Jahren geschrieben wurden. Im Mittelpunkt sieht sie die Liebesgeschichte zwischen einem Jungen aus Ostberlin und einem Mädchen aus München, die sich leidenschaftliche Briefe schreiben, deren Romanze nach dem Mauerfall aber schnell vorbei ist. Zwanzig Jahre später muss der Junge, nun Schriftsteller, entdecken, dass seine Briefe damals von der Stasi gelesen und als staatsfeindlich eingestuft wurden. Besonders haben Messmer die Liebesgedichte des Jungen sowie die Schilderung des Mauerfalls gefallen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH