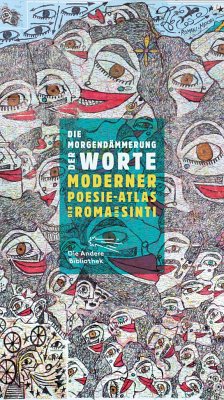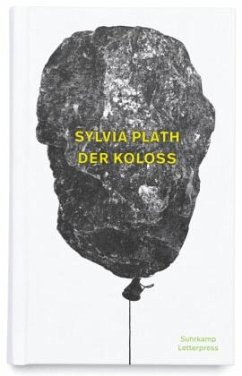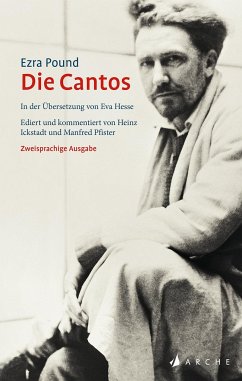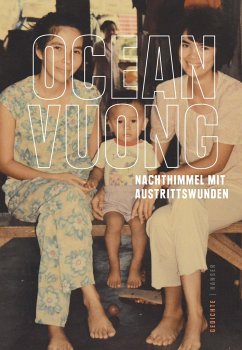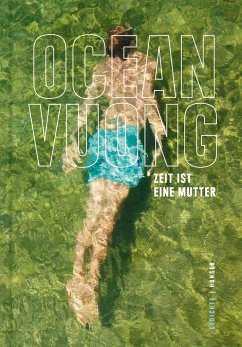Ich selbst, auch ich tanze
Die Gedichte
Mitarbeit: Lühe, Irmela von der

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Nur von den Dichtern erwarten wir Wahrheit (nicht von den Philosophen, von denen wir Gedachtes erwarten)«, schrieb Hannah Arendt in ihrem »Denktagebuch«. Doch was bisher nur Kennern des Werkes der berühmten Theoretikerin bekannt war: Sie verfasste neben ihren politischen Schriften jahrzehntelang auch selbst Lyrik. Dieser Band versammelt nun erstmals sämtliche Gedichte Arendts, die sie zwischen 1923 und 1961 schrieb, darunter acht bislang völlig unbekannte Werke. Arendts Poesie wirft ein neues Licht auf ihr Denken und Fühlen und muss wie ein sprachlich betörender, oftmals poetisch ori...
»Nur von den Dichtern erwarten wir Wahrheit (nicht von den Philosophen, von denen wir Gedachtes erwarten)«, schrieb Hannah Arendt in ihrem »Denktagebuch«. Doch was bisher nur Kennern des Werkes der berühmten Theoretikerin bekannt war: Sie verfasste neben ihren politischen Schriften jahrzehntelang auch selbst Lyrik. Dieser Band versammelt nun erstmals sämtliche Gedichte Arendts, die sie zwischen 1923 und 1961 schrieb, darunter acht bislang völlig unbekannte Werke. Arendts Poesie wirft ein neues Licht auf ihr Denken und Fühlen und muss wie ein sprachlich betörender, oftmals poetisch origineller Kommentar eines Schaffens gelesen werden, das sich ganz dem leuchtenden Widerstand gegen finstere Zeiten verschrieben hatte. Eine seltene Neuentdeckung.