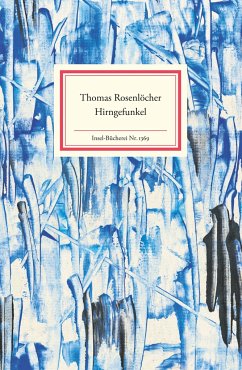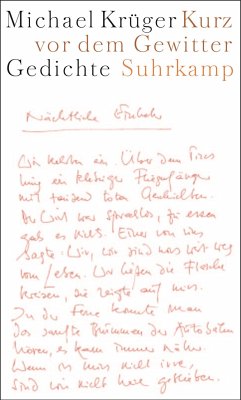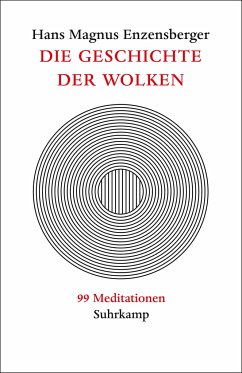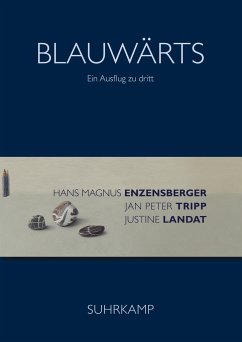Ich sitze in Sachsen und schau in den Schnee
77 Gedichte
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
18,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Dieser Lyrikband Thomas Rosenlöchers wurde aus den beiden bereits zu DDR-Zeiten erschienenen Bänden »Ich lag im Garten bei Kleinzschachwitz« und »Schneebier« zusammengestellt. Etwas vom Damals ins Heute retten, das will Thomas Rosenlöcher mit dem vorliegenden Band, dessen Gedichte mit dem Wegfall des alten Staates nun auch schon eine Zeitenwende hinter sich haben - und plötzlich gelten sie auch für heute. Humorvoll bis sarkastisch, mit Ironie und nicht unkritischem Auge betrachtet Thomas Rosenlöcher sich, den Zeitgenossen im Umbruch, seine Umgebung, und immer wieder wandert sein Blic...
Dieser Lyrikband Thomas Rosenlöchers wurde aus den beiden bereits zu DDR-Zeiten erschienenen Bänden »Ich lag im Garten bei Kleinzschachwitz« und »Schneebier« zusammengestellt. Etwas vom Damals ins Heute retten, das will Thomas Rosenlöcher mit dem vorliegenden Band, dessen Gedichte mit dem Wegfall des alten Staates nun auch schon eine Zeitenwende hinter sich haben - und plötzlich gelten sie auch für heute. Humorvoll bis sarkastisch, mit Ironie und nicht unkritischem Auge betrachtet Thomas Rosenlöcher sich, den Zeitgenossen im Umbruch, seine Umgebung, und immer wieder wandert sein Blick auch nach oben - der Himmel über Sachsen ist der Himmel über der Welt.