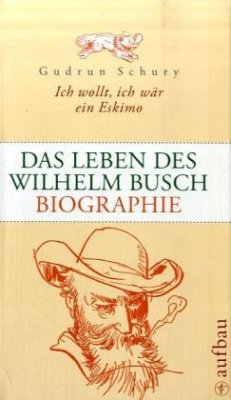Wer war Wilhelm Busch? Jedes Kind kennt Max und Moritz und die fromme Helene. Doch wer war der heiter-bissige Humorist, der sie erfand? Mit Witz und Verve zeichnet Gudrun Schury ein facettenreiches Porträt, das den meistgelesenen deutschen Dichter erstmals auch als Avantgardisten und künstlerischen Neuerer des 20. Jahrhunderts zeigt. Seine Zeichenkunst nimmt den Comic vorweg und beeinflusste Walt Disney, seine Gedichte und Erzählungen sind das Gegenteil biedermeierlicher Behaglichkeit, in seinem malerischen Spätwerk stößt er zum Expressionismus vor. Aus ungewöhnlicher Perspektive schaut Gudrun Schury dem Künstler in die Karten. Sie fragt nach Buschs Verhältnis zu den Frauen, zu den Kindern, zu den Tieren, zum Tabak- und Alkoholkonsum ("Jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank!"). Sie verfolgt den Weg seiner Bilder vom Bleistift über den Holzstich bis aufs bedruckte Papier. Sie betrachtet Prügelszenen und Todesarten seiner Figuren. Und sie befreit den populären Zeichner und Versemacher von Vorurteilen. Nur eines bestätigt sich am Ende: Wilhelm Busch bleibt einzigartig.

Zum Doppeljubiläum von Wilhelm Busch sind gleich zwei Biographien erschienen. Perfekt ergänzt werden sie von Gert Uedings revidierter Studie zu Leben und Werk.
Aus einer Zeit vor wenigen Monaten, als der hessische Landtagswahlkampf noch bestimmt war vom Thema Bildung, stammt ein Wahlplakat der Grünen, das unter der Parole "Die neue Schule" den Lehrer Lämpel aus Wilhelm Buschs "Max und Moritz" zeigt - aber mit den geschickt in Holzstich-Ästhetik hineinmontierten Gesichtszügen von Roland Koch. Eine Erklärung braucht das Plakat gar nicht: Jedem Betrachter ist klar, dass erstens über Koch gespottet werden soll und er zweitens aus Sicht der Grünen für ein veraltetes Bildungsideal steht. Denn die Figuren von Wilhelm Busch sind auch hundertdreiundvierzig Jahre nach deren erstem Auftritt und genau hundert Jahre nach dem Tod des Zeichners (F.A.Z. vom 9. Januar) so präsent, dass einem die Zeilen dazu sofort einfallen: "Also lautet ein Beschluß: / Daß der Mensch was lernen muß. / ... / Daß dies mit Verstand geschah / War Herr Lehrer Lämpel da. / Max und Moritz, diese beiden, / Mochten ihn darum nicht leiden."
Verblüffend, dass dieses Plakat funktioniert. Denn Wilhelm Busch hat Max und Moritz ja keineswegs als Ideale gezeichnet und bedichtet, sondern als rechte Lausbuben, die am Ende eine Strafe erfahren, die gewiss auch Roland Koch als weitaus zu radikal erschiene. Lehrer Lämpel ist in der Bildergeschichte ein aufrechter Pädagoge mit den besten Absichten, dem übel mitgespielt wird. Und dennoch: Er gilt als Zerrbild des Lehrerstands. Das verdankt sich einmal Buschs unfassbarem Talent als karikierender Zeichner, der in Lämpel, welcher als Licht der Aufklärung sogar einen sprechenden Namen trägt, das grandiose Zerrbild eines unausgesprochen selbstherrlichen Schulmeisters schuf - spinnenfingrig, nickelbebrillt, schmaläugig -, und zum anderen der Sympathie, die die Lausbuben seit ihrem Debüt bei den Lesern genießen. Man mag es wenden, wie man will: Wir stehen immer auf der Seite von Max und Moritz.
Damit ist die spezifische Leistung von Buschs Bildergeschichten angesprochen: Sie stürzen uns in einen moralischen Zwiespalt, der aber gar nicht explizit aufgelöst werden muss, weil wir über das Erzählte lachen können. Lachen bedeutet immer einen Triumph, und wen interessierte schon noch, welche Schlachten im Gemüt zuvor geschlagen werden mussten? Nun, einige gibt es allerdings, die das interessiert. Es sind die Interpreten von Wilhelm Busch, diejenigen also, die sich auf die Ausdruckskraft seiner Reime einen Reim und von der Wirkungsmächtigkeit seiner Bilder ein Bild machen müssen.
In den nicht einmal neun Monaten zwischen dem 175. Geburtstag am 15. April 2007 und dem hundertsten Todestag am 9. Januar 2008 sind gleich mehrere Studien über Busch neu oder überarbeitet erschienen. Selbstverständlich lockt die natürliche Überlegenheit des Dezimalsystems, die gleich zweifach Grund zum Erinnern bescherte; aber diese Bücher sind auch die ersten, die auf die Ergebnisse der 2002 abgeschlossenen historisch-kritischen Werkausgabe zurückgreifen können. Besonders in deren gleichfalls vor wenigen Monaten neu aufgelegtem dreibändigen Teil, der sich Buschs Bildergeschichten widmet (F.A.Z. vom 28. Juli 2007), hat Bearbeiter Hans Ries eine solche Fülle an Material zusammengetragen, dass man aus den Essays und Digressionen des Kommentars unschwer eine Biographie zusammenstellen könnte, die jedes konkurrierende Werk an Umfang und Informationsdichte überträfe - aber, und dies ist der Zug der Zeit, nicht zugleich an Lesbarkeit.
Deshalb ist es hocherfreulich, dass gleich zwei ganz neue Biographien zu Wilhelm Busch erschienen sind, zudem beide von Frauen geschrieben, während die Busch-Forschung bislang eine Domäne der Männerwelt war. Unterschiedlicher indes hätten die Biographien im Tenor nicht ausfallen können: Die Musikwissenschaftlerin und Germanistin Eva Weissweiler führt uns den dunklen Busch vor, einen, den auch Thomas Kluge im Nachwort zu seiner Textauswahl "Wilhelm Busch für Boshafte" im Blick hat, wenn er bei dem Dichter "durchgängig Inszenierungen von Boshaftigkeit" feststellt. Eva Weissweiler nennt ihn einen "lachenden Pessimisten", dessen Gelächter aber nur eines der Schadenfreude und des Hohns ist. Als Leitmotiv von Buschs Schaffen hält sie fest: "Der Mensch ist im Kern seines Wesens vielleicht nicht durchweg schlecht. Aber er ist unerziehbar und bleibt immer das Wesen, als das er geboren wurde."
Jeder auch nur oberflächliche Kenner von Buschs Werk weiß, dass diese Einschätzung durch Hunderte von Bemerkungen und Verse gedeckt ist. Eine, die Kluge ausgewählt hat, möge genügen: "Man ist ja von Natur kein Engel, / Vielmehr ein Welt- und Menschenkind. / Und ringsumher ist ein Gedrängel / Von solchen, die dasselbe sind." Deshalb würde die Literaturwissenschaftlerin Gudrun Schury als zweite aktuelle Busch-Biographin der Kollegin und Konkurrentin Weissweiler hier nicht widersprechen, doch ihr Buch stellt dennoch einen ganz anderen Künstler vor: den lichten Busch. Ist der Dichter und Zeichner bei Frau Weissweiler ein Misanthrop (und speziell ein misogyner), der seiner Familie, bei der er sich in den letzten dreißig Jahren seines Lebens einnistete, das Leben ebenso vergällt hat wie all den Freunden, die er sich vom Leibe hielt, und den Frauen, die er verachtete (Liebe habe er nur im Bordell gesucht), so ist Wilhelm Busch in Frau Schurys Augen ein liebenswürdiger Familienmensch, der seinen Neffen und Großneffen gegenüber wie ein gütiger Großvater auftrat, seinen Freunden als treue Seele und den Frauen als ein Charmeur. Was stimmt denn nun?
Das ist Auslegungs- und nicht zuletzt Geschmackssache. Geschmack deshalb, weil man sich eben entscheiden muss, ob man etwa Buschs Freundschaft zu dem Dirigenten Hermann Levi als Zeichen dafür deuten will, dass der Künstler generell kein Antisemit (so Gudrun Schury) oder nur in diesem Fall frei von Antisemitismus (so Eva Weissweiler) war. Wobei Weissweilers Buch immer zunächst nach dem Schlimmsten sucht und, wo es eben geht, eine kritische Position einnimmt, während Schurys Biographie eher dazu neigt, heikle Fragen mit einem eleganten Federstrich beiseitezuschieben.
Das Überraschende nun ist, dass Frau Schurys Buch trotzdem das deutlich bessere ist. Es ist erst einmal viel flüssiger geschrieben, nämlich mit erkennbarem Spaß an der Sache und etlichen klugen Interpretationen zu Einzelwerken, während sich Frau Weissweiler mit ihrem ach so unerquicklichen Gegenstand bisweilen selbst quält und kaum einmal eine erhellende Bemerkung zu einem der Werke macht. Ausgerechnet über "Max und Moritz" etwa erfahren wir, dass dem Buch zunächst kein großer Erfolg beim Publikum beschieden war. Das stimmt - aber nur für zwei Jahre. Mehr dazu ist aber nicht zu lesen. Dafür gibt es einen Exkurs über die Hexenverbrennungen in Buschs Heimatdorf Wiedensahl. Dass deren letzte 1660 durchgeführt wurde, also 172 Jahre vor Buschs Geburt, muss man bei Gudrun Schury nachlesen. Eva Weissweiler dagegen beschließt ihre entsprechende Abschweifung mit dem Satz: "Die letzte Hinrichtung hatte 1832 - das Geburtsjahr Wilhelm Buschs - stattgefunden." Gemeint ist damit jedoch die letzte Hinrichtung eines Verurteilten im Königreich Hannover, gesagt wird das leider nicht.
Geht Frau Weissweiler schön brav chronologisch vor, hat sich Frau Schury das Prinzip von Modest Mussorgskys Klavierzyklus "Bilder einer Ausstellung" zum Vorbild genommen: Bei ihr wechseln "Passagen" (im Präteritum erzählte Rückblicke aufs Leben) mit "Bildern" ab, die als biographische Schwerpunkte im Präsens geschrieben sind. So kommt noch mehr Leben in den Text, und die Qualität der Abbildungen ist bei Gudrun Schury auch höher als im Buch von Eva Weissweiler.
Beide haben aber noch eine weitere Konkurrenz: die schon vor dreißig Jahren erschienene Wilhelm-Busch-Studie des Tübinger Literaturwissenschaftlers Gert Ueding, die nun überarbeitet neu aufgelegt worden ist. Bei Erscheinen provozierte sie mit ihrer psychoanalytischen Deutung viel Widerspruch, deren Nachwirkungen bis in die Kommentare von Hans Ries in der Busch-Gesamtausgabe zu finden sind. Für Weissweiler und Schury ist Ueding keine bestimmende Bezugsgröße mehr; das rächt sich, denn in seinem Buch wird Busch wohlbegründet zum exemplarischen Künstler des neunzehnten Jahrhunderts erklärt - und diese Interpretation ist auch heute noch die radikalste, weil sie in Busch einen "Optimisten für die Zukunft" erkennt. Biographisch ist bei Ueding nicht so viel zu holen, dafür aber kunstgeschichtlich und literarisch. Und das ist bei Wilhelm Busch immer noch die Hauptsache.
ANDREAS PLATTHAUS
Gudrun Schury: "Ich wollt, ich wär ein Eskimo". Das Leben des Wilhelm Busch. Aufbau Verlag, Berlin 2007. 412 S., 16 Tafeln, Abb., geb., 24,95 [Euro].
Eva Weissweiler: "Wilhelm Busch - Der lachende Pessimist". Eine Biographie. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007. 381 S., Abb., geb., 19,90 [Euro].
Gert Ueding: "Wilhelm Busch". Das 19. Jahrhundert en miniature. Erweiterte und revidierte Neuausgabe. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2007. 429 S., Abb., geb., 26,80 [Euro].
"Wilhelm Busch für Boshafte". Ausgewählt von Thomas Kluge. Insel Taschenbuch, Frankfurt am Main 2007. 138 S., br., 6,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Freudig begrüßt Andreas Platthaus diese Biografie Wilhelm Buschs, die Gudrun Schury zum hundertsten Todestag des Zeichners und Dichters vorgelegt hat. Keinen Zweifel lässt er daran, dass ihm Schurys Buch besser gefallen hat als die ebenfalls von ihm besprochene Busch-Biografie von Eva Weissweiler, die sich auf den Pessimisten und Misanthropen Busch einschieße. Schury leugne zwar den Pessimismus bei Busch nicht. Dennoch findet er bei ihr einen anderen Künstler: den "lichten Busch", einen liebenswürdigen, großzügigen, charmanten Familienmenschen. Platthaus räumt ein, dass es Schury versteht, heikle Punkte elegant beiseite zu schieben. Dennoch zieht er Schurys Arbeit der von Weissweiler vor. Aus mehreren Gründen: Er hält sie für lebendiger, besser aufgebaut und schöner geschrieben. Zudem scheint ihm Schury im Unterschied zu Weissweiler mit "erkennbarem Spaß" bei der Sache. Schließlich findet er bei ihr zahlreiche "kluge" Interpretationen zu den einzelnen Werken Buschs.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH