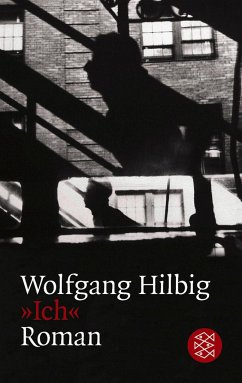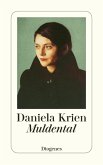Der Schriftsteller und Stasi-Spitzel Cambert soll einen mysteriösen Autor beschatten, der "feindlich-negativer Ziele" verdächtigt wird. Da dieser Autor nie den Versuch macht, seine Texte zu veröffentlichen, ist der Verdacht jedoch schwer zu erhärten. Camberts Zweifel an der Notwendigkeit seiner Aufgabe, die ihn zu unheimlichen Expeditionen durch Berliner Kellergewölbe zwingt, wachsen mit der Unsicherheit, ob sich das Ministerium für Staatssicherheit für seine Berichte überhaupt interessiert. Immer öfter plagt ihn die Ahnung, nicht einmal seine Person werde ernst genommen. In dem muffigen Zimmer zur Untermiete bei Frau Falbe, die ihm keineswegs nur Kaffee kocht, verschwimmen ihm Dichtung und Spitzelbericht so sehr, daß er bald nichts mehr zu Papier bringen kann. Tief sitzt die Angst, unter dem Deckmantel Cambert könnte der lebendige Mensch längst verschwunden sein...
Wolfgang Hilbigs Thema in diesem atmosphärisch dichten, musikalischen Roman ist die Verwicklung von Geist und Macht. Er untersucht sie am Beispiel eines Literaten, der zu einem Spitzel der Staatsgewalt geworden ist. Indem Hilbig diesen Fall konsequent zu Ende denkt, gewinnt er ihm zahlreiche komische Wendungen und prächtige sarkastische Pointen ab.
Wolfgang Hilbigs Thema in diesem atmosphärisch dichten, musikalischen Roman ist die Verwicklung von Geist und Macht. Er untersucht sie am Beispiel eines Literaten, der zu einem Spitzel der Staatsgewalt geworden ist. Indem Hilbig diesen Fall konsequent zu Ende denkt, gewinnt er ihm zahlreiche komische Wendungen und prächtige sarkastische Pointen ab.

1993 - Die Literatur ist die Stasi, und die ist die Literatur
Man kann natürlich auch alles einzeln lesen: Feuilletondebatten über die Verstrickung von Geist und Macht, Stasiaktenberge, Literaturgeschichten und, sofern einem danach ist, Sascha Andersons "Sascha Anderson". Oder eben gleich Wolfgang Hilbigs Roman "Ich", das All-Inklusive-Paket, wo all das und noch viel mehr schon drinsteckt. Es ist die vielleicht wahrere Geschichte von Anderson, die von Rainer Schedlinski, die von Wolfgang Hilbig, wenn er ein IM der Stasi geworden wäre. Das ist er aber nicht geworden. Der dichtende Heizer aus dem sächsischen Bergbaukaff Meuselwitz hatte der DDR widerstanden, er ließ sich nicht zum schreibenden Arbeiterklassenbesten stilisieren und nicht anwerben. Er ging 1985 in den Westen. Als erst die DDR zerbrach und nur das Renommee ihrer Literatur zu bleiben schien, dann aber auch das Renommee ihrer Literaten an deren Stasikontakten zu zerbrechen drohte - es betraf damals auch Heiner Müller und Christa Wolf -, da schwieg Hilbig, der noch am ehesten das Recht zur moralischen Entrüstung gehabt hätte. Von ihm kam nichts außer 1993 dieses Buch, ein schwergewichtiges, vollblütiges Stück Literatur als Kommentar zu einem Thema, das er als ein literarisches begriff und in Literatur auflöste. Oder auch umgekehrt.
Es ist die Geschichte eines Dichters, der zum Stasispitzel wird, und die ganze Zeit klingt es so, als sei zwischen beidem ohnehin kaum ein Unterschied, weil Erzählungen automatisch Denunziationen sind. Dieser Dichter heißt Ich, "Ich", M. W., W., Cambert, C.; und es ist nicht nur so, daß sein fragiles Ich zwischen Decknamen und Scheinexistenzen völlig zerfasert, es wird dadurch auch erst konstituiert: am Anfang ist es ein Arbeiter in einem sächsischen Kaff, der nebenher schreibt, der bald auch, halb erpreßt, halb freiwillig, für die Stasi schreibt, der sich emporschreibt bis nach Berlin, wo er tags durch die labyrinthischen Keller huscht wie eine Kanalratte und nachts die inoffizielle Literatenszene von Prenzlauer Berg bei ihren hermetischen Lesungen in Hinterhofwohnungen belauscht. Und die poststrukturalistischen Modesprüche dort, der Tanz um das unablässig gold kalbende Schlüsselwort "Simulation" decken sich exakt mit den Dialektik-Pirouetten seines Führungsoffiziers, eines eleganten, brutalen Schweins, das sich Feuerbach nennt und auch entsprechende Thesen hat: "Die meisten guten Gedanken kommen vom Gegner, es kommt aber darauf an, sie zu verändern."
Alles ist mehrfach nach innen gekrempelt, nicht leicht zu lesen, dann aber auch wieder hochkomisch in den unzähligen satirischen Anspielungen auf die Literaturszene der DDR und auf die Literaturgeschichte im allgemeinen, in den torkelnden Dialogen mit dem Führungsoffizier, in der Schilderung einer Gesellschaft, wo der Mensch dem Menschen ein Genitiv ist, ein zersetzender Schatten. Und ganz meisterhaft eingefangen ist in Hilbigs Buch die Lebensatmosphäre in den späten Jahren jener DDR, die damals gerade dabei war, von der "sogenannten" zur "ehemaligen" zu werden. Ein Land in Gänsefüßchen, ein Gespinst wie dieses "Ich", demgegenüber dasjenige Rimbauds regelrecht übersichtlich wirkt. Sicher war es ein Risiko, diesen Stoff von der Straße zu sammeln, als er noch so aktuell war, daß er jeden Tag die Zeitungen füllte, und ganz gewiß war es problematisch, so früh schon die Trennlinie zwischen Tätern und Opfern unter pathetischen und sarkastischen Wortkaskaden zuzudecken und zu leugnen. Aber Hilbigs Buch gewinnt seither mit jedem Jahr und wird nicht inaktuell: Weil phantastische Literatur an diesem Gegenstand das einzig Realistische ist, und weil man es auch als böse Satire auf die literarische und geistesgeschichtliche Moderne lesen kann. Der große Dichter Hilbig sollte ohnehin mehr gelesen werden. Im Falle von "Ich" ist das, benutzen wir das böse Wort einfach mal: eine Verpflichtung.
ripe
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main