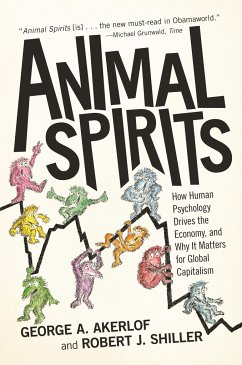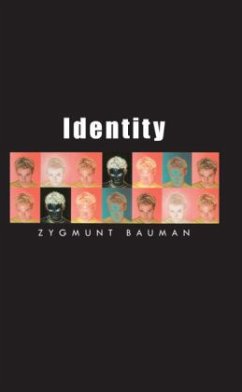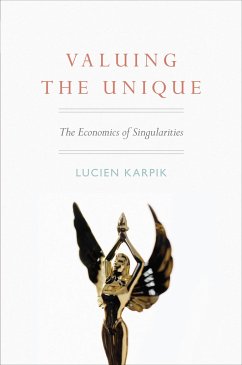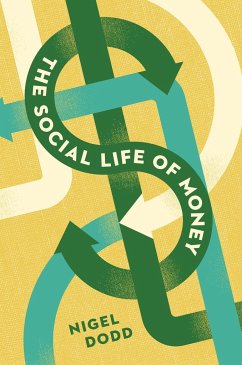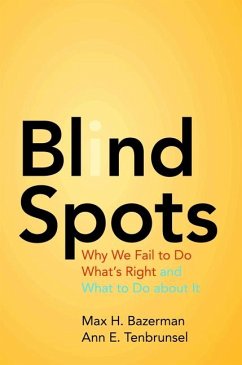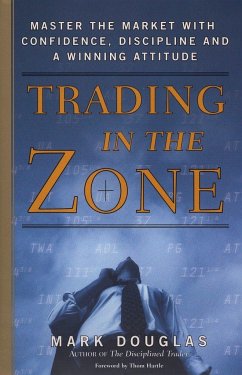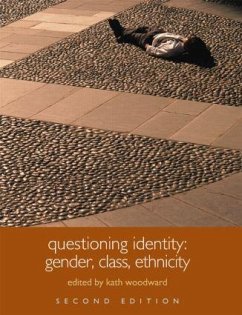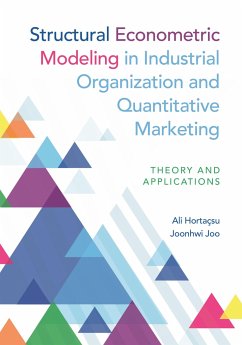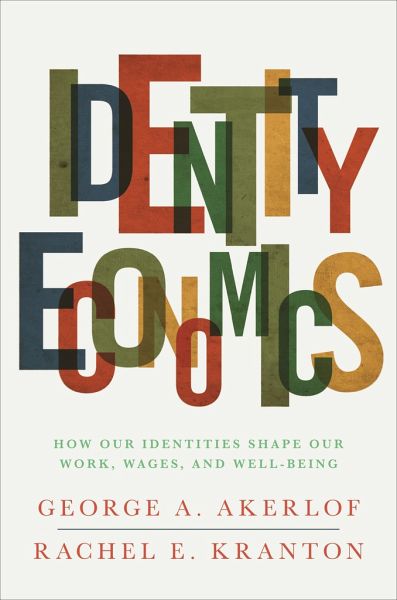
Identity Economics
How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being

PAYBACK Punkte
14 °P sammeln!
Provides an important way to understand human behavior, revealing how our identities - and not just economic incentives - influence our decisions. This title explains how our conception of who we are and who we want to be may shape our economic lives more than any other factor, affecting how hard we work, and how we learn, spend, and save.