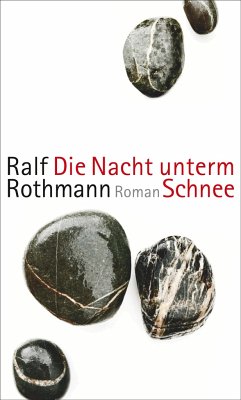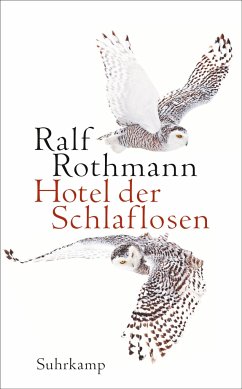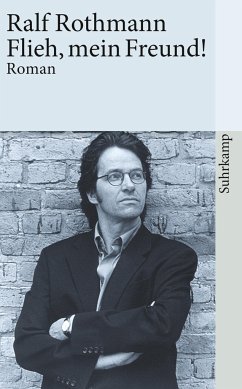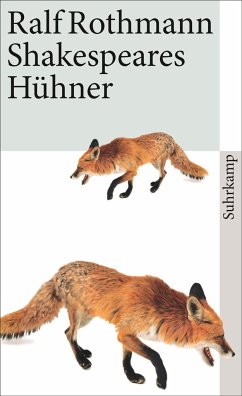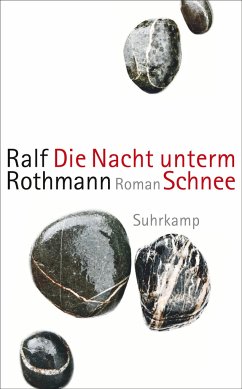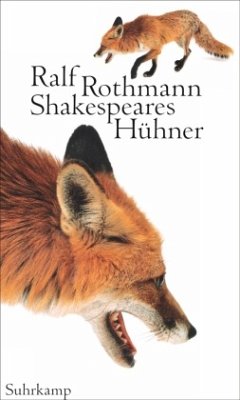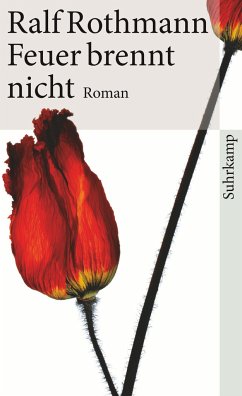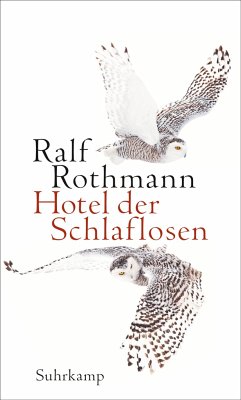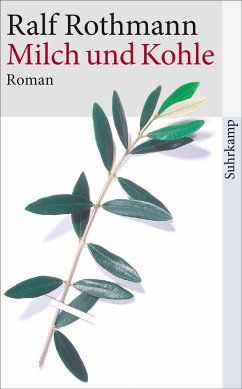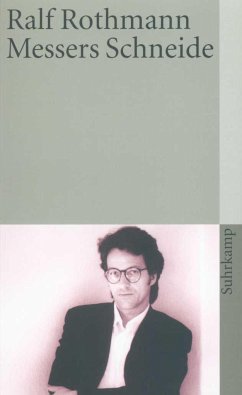Im Frühling sterben
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
12,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Im Frühling sterben ist die Geschichte von Walter Urban und Friedrich - »Fiete« - Caroli, zwei siebzehnjährigen Melkern aus Norddeutschland, die im Februar 1945 zwangsrekrutiert werden. Während man den einen als Fahrer in der Versorgungseinheit der Waffen-SS einsetzt, muss der andere, Fiete, an die Front. Er desertiert, wird gefasst und zum Tod verurteilt, und Walter, dessen zynischer Vorgesetzter nicht mit sich reden lässt, steht plötzlich mit dem Karabiner im Anschlag vor seinem besten Freund ... In eindringlichen Bildern erzählt Ralf Rothmann vom letzten Kriegsfrühjahr in Ungarn, i...
Im Frühling sterben ist die Geschichte von Walter Urban und Friedrich - »Fiete« - Caroli, zwei siebzehnjährigen Melkern aus Norddeutschland, die im Februar 1945 zwangsrekrutiert werden. Während man den einen als Fahrer in der Versorgungseinheit der Waffen-SS einsetzt, muss der andere, Fiete, an die Front. Er desertiert, wird gefasst und zum Tod verurteilt, und Walter, dessen zynischer Vorgesetzter nicht mit sich reden lässt, steht plötzlich mit dem Karabiner im Anschlag vor seinem besten Freund ...
In eindringlichen Bildern erzählt Ralf Rothmann vom letzten Kriegsfrühjahr in Ungarn, in dem die deutschen Offiziere ihren Männern Handgranaten in die Hacken werfen, damit sie noch angreifen, und die Soldaten in der Etappe verzweifelte Orgien im Angesicht des Todes feiern. Und wir erleben die ersten Wochen eines Friedens, in dem einer wie Walter nie mehr heimisch wird und noch auf dem Sterbebett stöhnt: »Die kommen doch immer näher, Mensch! Wenn ich bloß einen Ort für uns wüsste ...«
In eindringlichen Bildern erzählt Ralf Rothmann vom letzten Kriegsfrühjahr in Ungarn, in dem die deutschen Offiziere ihren Männern Handgranaten in die Hacken werfen, damit sie noch angreifen, und die Soldaten in der Etappe verzweifelte Orgien im Angesicht des Todes feiern. Und wir erleben die ersten Wochen eines Friedens, in dem einer wie Walter nie mehr heimisch wird und noch auf dem Sterbebett stöhnt: »Die kommen doch immer näher, Mensch! Wenn ich bloß einen Ort für uns wüsste ...«