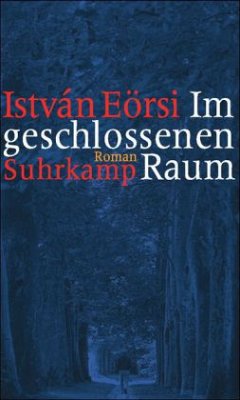Ein ungarischer Schriftsteller, Alter ego des kämpferischen Moralisten István Eörsi, gibt einer jungen Journalistin aus England bereitwillig Auskunft über sein Leben. Sie sitzen auf der Terrasse eines Sommerhauses auf einer kleinen Donauinsel unweit von Budapest, die nur mit der Fähre zu erreichen ist. Der Versuch, lästige Besucher aus der Vergangenheit abzuschütteln, scheitert - genauso wie das geplante Zeitungsinterview. Statt über sein einst verbotenes Theaterstück Im geschlossenen Raum spricht Eörsis Held über den Alltag in Zeiten der Diktatur, wo Spitzel und ihre Opfer, ehemals verfolgte Kommunisten und ihre Henker, im geschlossenen Raum der Gesellschaft miteinander auskommen müssen.
Unterhaltsam und witzig, voller Charme und Selbstironie erzählt István Eörsi, der streitlustigste ungarische Autor der Gegenwart, von erotischen Affären und herzzerreißenden Abschieden, von tragischen Entscheidungen und der Kunst, mutig zu sein vor Freund und Feind. Das beeindruckende Dokument einer unerschrockenen Selbstanalyse - zugleich ein kraftvoll gezeichnetes Bild der ungarischen Gesellschaft zwischen 1956 und 1989.
Unterhaltsam und witzig, voller Charme und Selbstironie erzählt István Eörsi, der streitlustigste ungarische Autor der Gegenwart, von erotischen Affären und herzzerreißenden Abschieden, von tragischen Entscheidungen und der Kunst, mutig zu sein vor Freund und Feind. Das beeindruckende Dokument einer unerschrockenen Selbstanalyse - zugleich ein kraftvoll gezeichnetes Bild der ungarischen Gesellschaft zwischen 1956 und 1989.

Schlimm: István Eörsi zeigt den Eros des politischen Intellektuellen
István Eörsi ist eine kanonische Größe in Ungarn: als vielleicht einflußreichster literarischer Publizist der vergangenen Jahrzehnte. Man sehe und staune nur, was für einen Kranz von Attributen György Konrád dem im Herbst 2005 im Alter von vierundsiebzig Jahren gestorbenen Autor nachgeworfen hat: Ein "Sporn in der Flanke des Staates" sei Eörsi gewesen, ein "Republikaner", "Ironiker", "Sportsmann", "Wettkämpfer", "Champion des Alltags", "treuer und treuloser Ehemann", "antisentimentaler Sentimentaler", "dahinpreschender Moralist" und "possenreißerischer Stoiker", der den Humor auch in bitterernsten Situationen nicht verloren habe.
Dabei hat Konrád noch vieles ausgelassen. Für das Kádár-Regime zum Beispiel war Eörsi vor allem eines: Konterrevolutionär. 1956 wurde er wegen publizistischer Unterstützung von Imre Nagy zu acht Jahren Haft verurteilt. Der blutig erstickte Ungarn-Aufstand, der sich in diesem Herbst zum fünfzigsten Mal jährt, hat sein Leben geprägt. Das Gefängnisstück "Das Verhör" wurde zu seinem umstrittensten und berühmtesten Werk.
Es bildet auch den Fixpunkt des autobiographischen Romans "Im geschlossenen Raum", der drei Jahre nach dem Original nun auf deutsch erschienen ist und als wichtigste literarische Gabe zum Jubiläum der ungarischen Revolution gelten darf. Wie Eörsis Gefängnismemoiren "Erinnerungen an die schönen alten Zeiten" (1991) ist es ein Werk von sarkastischem Humor.
Über die berühmten Selbstporträts in den Museen und Galerien heißt es an einer Stelle: "Sie triefen nur so von Nachsicht, von nicht zu unterdrückender Zärtlichkeit, die der Maler seinem Gegenstand entgegenbringt." Ein unnachsichtiges Selbstporträt - darauf hat es Eörsi angelegt. Borsi heißt sein Alter ego, das wir im geschichtsträchtigen Sommer 1989 kennenlernen. Der auf die Sechzig zugehende Schriftsteller lebt zurückgezogen auf einer Insel in der Donau. Die junge Journalistin Erzsébet - eine Exil-Ungarin, die in England lebt - besucht ihn, um ein langes Interview mit ihm zu führen. Vor allem will sie etwas erfahren über sein legendäres Stück "Im geschlossenen Raum" und dessen Nicht-Aufführungsgeschichte. Borsi aber erzählt ihr sein Leben. Daß beides schließlich aufs gleiche hinauslaufe, ist die Voraussetzung dieses Romans.
Borsi ist eine Reizfigur; mit seiner provokativen moralischen Unbeflecktheit geht er vielen auf die Nerven, die den Kompromiß für die bessere Lebensform gehalten haben. Die also für Geld, billige Grundstücke, Übersetzungen in die Weltsprachen, West-Autos, Reisepässe oder einfach nur für die Nähe zur Macht empfänglich waren. Die Diktatur zeigte ein joviales Antlitz, und der Autor konnte sich entscheiden, Nutznießer oder Nichtsnutz zu sein.
Hartnäckig sträubt sich Borsi gegen das große Vergessen, das vom Kádár-Regime seit den sechziger Jahren empfohlen wird. Er hält die Erinnerung wach: an die Arroganz der Macht und die Zeremonien der Demütigung, die hingerichteten Freunde, ausgeschlagenen Zähne und blauen Flecken, die Zauberkünste des Opportunismus, die abverlangten Gesten der Selbstkritik, die Spitzeleien und Denunziationen. Erst recht vor diesem Hintergrund macht ihm die Vorstellung, daß Erzsébet ein ganzseitiges Porträt von ihm im "Times Literary Supplement" veröffentlichen wird, ein geradezu diebisches Vergnügen: "Der gesamte Schriftstellerverband würde vor Wut schäumen, seine Freunde und sonstigen Feinde würde der Schlag treffen."
Aber auch die Borsi-Figur schillert. Ist sie ein Held des Widerstands, die nicht zur Gelassenheit übergehen will? Oder ein mittelmäßiger Schriftsteller, der an Erfolglosigkeit und zuviel Eigenliebe leidet? Der Welt wirft Borsi vor, daß sie ihn nicht anerkennt; aber bei jedem Zeichen von Anerkennung beginnt er, seine eigene moralische Integrität in Zweifel zu ziehen. Er weiß: Ohne die bitteren Erfahrungen der Haft wäre aus ihm kein Schriftsteller geworden. Ist also auch Borsi ein subtiler Kollaborateur der Verhältnisse? Hängt er der Zeit der Unterdrückung gar mit pervertierter Nostalgie an? ("Die Erschießungskommandos haben Sie definitiv verpaßt", meint Erzsébet einmal höhnisch.) Das sind abgründige Fragen, die der Roman mit bohrender Hartnäckigkeit umkreist. Er bietet eine akribische Erforschung der Künstlerseele in Zeiten der politischen Versuchung, ein Selbstporträt als Widerborst. Schon als Kind hatte Borsi Leuten, die ihn auf der Straße darauf aufmerksam machten, daß sein Schuhband offen war, trotzig entgegnet: "Dann binden Sie's zu!"
Kaum erstaunlich, daß Eörsi bei seinem 1965 geschriebenen Stück, das dem Roman den Titel gibt, zu keinerlei Kompromiß bereit war. So mußte es neunzehn Jahre auf die Erstaufführung warten. Sie fand in West-Berlin statt, an der Schaubühne, die im Roman als "Kleisttheater" firmiert.
Ernst Jandl hatte das Manuskript seinerzeit aus Ungarn herausgeschmuggelt. Die Szene, in der Borsi den verängstigten, aber mutig entschlossenen Lyriker um den gefährlichen Gefallen bittet, ist ein Höhepunkt des Buches: "Leichenblaß stammelte der Dichter ein beglücktes ,Ja' und setzte noch ein ,natürlich' hinzu, in einem Ton, der von Widernatürlichkeit des Unternehmens zeugte."
Am Ende gewinnt "Der geschlossene Raum" den Kritikerpreis für das beste Stück des Jahres - allerdings des Freiheitsjahres 1989. Zur Verleihung stellen sich alte Weggefährten, Rivalen und Gegner ein. Auch der ehemalige Zensor, ein Trottel namens Trübe, kommt und versichert: "Ich habe dieses Stück immer sehr geschätzt." Nicht alle Figuren des Buches werden so anschaulich wie dieser karikierte Kulturfunktionär dritten Ranges. Was Eörsi über seinen Lehrer Georg Lukács oder über Jandl schreibt, beweist allerdings, welchen Eindruck dieses Buch auf Leser machen muß, die hinter den Figuren die genau porträtierten "Genossen" erkennen.
Das Buch setzt mit einem Bekenntnis zum Antibelletristischen ein: "Als Leser konnte ich Beschreibungen nie ausstehen. Sie langweilten mich unglaublich." Dieser Aversion folgend, hält Eörsi auch im Roman den Beschreibungsaufwand gering. Es ist ein Gesprächsroman, der vor Intelligenz und untergründiger erotischer Spannung vibriert - zwischenzeitlich liegen der Autor und die Journalistin gemeinsam in Borsis breitem Bett, allerdings symbolisch getrennt von einem Ruder.
Borsi will Erzsébet nicht nur als maßlos integrer Autor, sondern auch als musischer Macho und sexueller Gourmet imponieren. Genüßlich breitet er vor ihr seine erotische Biographie aus und erzählt etwa von jenem Holzhäuschen, wo er einen froststarrenden Winter lang seine Schäferstündchen abhielt: "Mit bibbernden Akteurinnen exerzierte ich dort Grenzfälle des Glücks." In den materiell und politisch beengten osteuropäischen Verhältnissen wurde mit vereinten Kräften geliebt - der Eros als Ventil für Bedrückungen, wie man es schon bei Kundera lesen konnte.
So ging als erstes Borsis Ehe zugrunde. Während er im Gefängnis saß, hatte das Paar unverbrüchlich zusammengehalten. Danach lebten sie sich schnell auseinander: "Ich war zu begierig, zu ausgehungert, als ich durch das Gefängnistor trat. Ich wollte schwelgen, meine Frau hoffte hingegen, sich nach fast vierjähriger Hetze endlich ausruhen zu können." Immerhin hat Borsi eine Legitimation für seine Untreue, die etwas von Brechtscher Spruchweisheit hat: "Von den Menschen mit revolutionärem Naturell liegt nur den Genußfreudigen der Gedanke an Terror völlig fern."
Die Formel des "geschlossenen Raums" meint also vieles: Borsis Theaterstück, das Gefängnis, das Leben unter der Diktatur, aber auch die Interviewsituation, in der zwei fremde Menschen in spannungsreiche Nähe geraten. Ein geschlossener Raum ist schließlich auch der Körper, der im Liebesfall vom anderen annektiert wird.
Aber wen interessiert die schummrig-schikanöse Welt des realsozialistischen Kulturbetriebs noch? "Du röhrst wie der Hirsch am längst verlassenen Waldrand", wirft ein Kritiker des Manuskripts Borsi vor. Dem ist entgegenzuhalten, daß das Buch dank seines luziden analytischen Blicks auf menschliches Verhalten und unmenschliche Verhältnisse hohen Reiz entwickelt. Der Eros des politischen Intellektuellen, der im zwanzigsten Jahrhundert so wirkmächtig war, in den letzten zwei Jahrzehnten aber gründlich abgestorben ist, wird noch einmal lebendig. Borsi: ein Denkmal für den Dissidenten und zugleich seine Demontage.
WOLFGANG SCHNEIDER
István Eörsi: "Im geschlossenen Raum". Roman. Aus dem Ungarischen übersetzt von Heinrich Eisterer. Mit einem Nachwort von György Konrád. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2006. 323 S., geb., 22,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rezensentin Ilma Rakusa ist tief beeindruckt von Istvan Eörsis autobiografisch gefärbtem Roman, zu dessen Qualitäten sie Eörsis Schonungslosigkeit Freund und Feind aber auch sich selbst gegenüber zählt, ebenso wie seinen Witz und sinnlichen Charme. Über weite Strecken sei das als fiktives Interview konzipierte Buch eine in der Art der Bekenntnisse von Augustin bis Gombrowicz verfasste "skrupellose Selbstbefragung". Immer wieder zeigt sich die Rezensentin dabei fasziniert von Eörsis dramatischen Fähigkeiten, die sie ihn im verhörartig geführten Interview über die Zeit nach Stalins Tod bis zur Wende1989 entfalten sieht. Besonders die Episoden aus der Gefängniszeit von 1953 bis 1960 packen die Rezensentin sehr. Ihr gefällt aber auch die subtile Erotik in der Beziehung zwischen der fiktiven Interviewerin und dem Protagonisten des Romans, den die Rezensentin im Übrigen von Heinrich Eisterer "prägnant übersetzt" findet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH