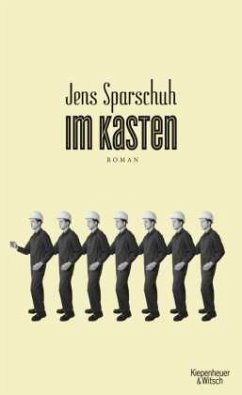Ordnung und spätes Leid - Jens Sparschuhs tragischer Held kommt völlig durcheinander
Hannes Felix ist seine Frau los: Monika kann sein sprödes Verhalten nicht mehr ertragen und packt ihren Koffer - leider völlig falsch. Sein Versuch, Ordnung in den wüsten Kofferinhalt zu bringen, gibt ihr den Rest und ihm die Gelegenheit, seine Vision von der optimalen Ordnung des Lebens künftig ganz ungestört umzusetzen.
Jens Sparschuh erzählt von einem obsessiven Charakter und einem kollektiven Phänomen mit hohem Wiedererkennungseffekt: der Beschäftigung mit Strategien, das Leben und die Dinge effizient zu ordnen. Bei NOAH ist sein Held an der richtigen Adresse. Die unausgelastete Firma für Neue Optimierte Auslagerungs- und Haushaltsordnungssysteme hat ihn mit großen Hoffnungen eingestellt, aber seine Ideen zur Ankurbelung des Geschäfts nehmen immer groteskere und komischere Züge an. Rückblenden in Felix' Kindheit und seine beruflichen Anfänge liefern Einblicke in die subtilen Mechanismen, die diese komplexe Psyche formten. Und das Vorhaben, die Geschäftsinteressen von IKEA mit denen von NOAH zu verknüpfen, den Firmensitz von der städtischen Peripherie ins Zentrum zu verlegen und dafür endlich den Neubau des Berliner Stadtschlosses zu stoppen, entwickelt eine unheimliche Sogwirkung. Die große Kunst von Jens Sparschuh liegt darin, mit Sprachwitz und Feingefühl einen sympathischen und hochneurotischen Don Quichotte von heute zu entwerfen, dem der Leser bei seiner Suche nach einer neuen, perfekten Ordnung mit banger Hoffnung und großem Vergnügen bis zum bitteren Ende folgt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hannes Felix ist seine Frau los: Monika kann sein sprödes Verhalten nicht mehr ertragen und packt ihren Koffer - leider völlig falsch. Sein Versuch, Ordnung in den wüsten Kofferinhalt zu bringen, gibt ihr den Rest und ihm die Gelegenheit, seine Vision von der optimalen Ordnung des Lebens künftig ganz ungestört umzusetzen.
Jens Sparschuh erzählt von einem obsessiven Charakter und einem kollektiven Phänomen mit hohem Wiedererkennungseffekt: der Beschäftigung mit Strategien, das Leben und die Dinge effizient zu ordnen. Bei NOAH ist sein Held an der richtigen Adresse. Die unausgelastete Firma für Neue Optimierte Auslagerungs- und Haushaltsordnungssysteme hat ihn mit großen Hoffnungen eingestellt, aber seine Ideen zur Ankurbelung des Geschäfts nehmen immer groteskere und komischere Züge an. Rückblenden in Felix' Kindheit und seine beruflichen Anfänge liefern Einblicke in die subtilen Mechanismen, die diese komplexe Psyche formten. Und das Vorhaben, die Geschäftsinteressen von IKEA mit denen von NOAH zu verknüpfen, den Firmensitz von der städtischen Peripherie ins Zentrum zu verlegen und dafür endlich den Neubau des Berliner Stadtschlosses zu stoppen, entwickelt eine unheimliche Sogwirkung. Die große Kunst von Jens Sparschuh liegt darin, mit Sprachwitz und Feingefühl einen sympathischen und hochneurotischen Don Quichotte von heute zu entwerfen, dem der Leser bei seiner Suche nach einer neuen, perfekten Ordnung mit banger Hoffnung und großem Vergnügen bis zum bitteren Ende folgt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Dass Jens Sparschuh herausragend kleinkarierte Typen schildern kann, weiß Rezensent Eberhard Falcke bereits seit dessen Roman "Der Zimmerspringbrunnen". Dass er sich allerdings auch auf "Loriot-Komik" versteht, verdeutlicht ihm jetzt erst sein neuer, äußerst witziger Roman "Im Kasten". Hier begegnet der Kritiker dem ordnungsfanatischen Romanhelden Hannes, der seiner Aufräum-Leidenschaft nicht nur beruflich in einer Self-Storage-Firma nachgeht, sondern auch ebenso pedantisch und eindimensional über sein Privatleben und seine gescheiterte Ehe reflektiert. Den Rezensenten erinnert Sparschuhs treffend beschriebene Kunstfigur an die "extremen Charaktere" Elias Canettis, der sich ebenfalls mit den Einseitigkeiten des spezialisierten Menschen beschäftigt habe.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Was uns die Bücher dieses Frühjahrs erzählen: Die Terrorzelle der Gegenwart ist das Büro. Und eine Flucht daraus ist in der Welt, in der wir heute leben, unmöglich
Büros sind moderne Terrorzellen. Denn all die Wetten der Finanzmärkte, die gegen Staaten abgeschlossen werden, die ruinösen Spekulationen und irrationalen Entscheidungen, die unsere Zukunft bedrohen - sie werden schon lange nicht mehr auf dem Parkett der Börsen gefällt. Sie kommen aus Büros in London, New York, Frankfurt am Main oder aus denen der Offshore-Finanzplätze wie den Kaimaninseln in der Karibik. In diesen Büros - klimatisiert, mit feiner Adresse und ausgesuchtem Design - bestimmen Investmentbanker, Hedgefondsmanager, Angestellte von Rating-Agenturen und Zocker unsere Wirklichkeit. Und als wenn das nicht schon genug wäre, sitzen wir zur selben Zeit mit dreißig Millionen anderen Deutschen in unseren eigenen Bürozellen und terrorisieren uns untereinander. Mobbing, Selbstoptimierung, Coaching und Burnout nennen wir das.
Dieser Hölle entkommt man nicht. Schon gar nicht in der Literatur dieses Frühjahrs. Die Bücher nämlich, die man jetzt lesen kann, sind voller Controller, Versicherungsvertreter und Zwangsneurotiker. Es sind Bücher aus der bösen Welt der Angestellten, in denen mutwillig Abhängigkeitsverhältnisse eingegangen werden (die Affäre mit dem Vorstand), Belohnungsrituale ausgekostet (der Bordellbesuch für die männliche Belegschaft nach dem "Ergo"-Prinzip) und in denen die Angst vor der Entlassung den eigentlichen Leistungsantrieb darstellt.
Wer in der letzten Zeit den Eindruck hatte, das Angestelltenbüro sei vom Aussterben bedroht, es sei altmodisch und over, weil die jungen Kreativen der digitalen Boheme sich über den "unflexiblen Menschen" erhoben und die postbürokratische Ordnung jenseits der Festanstellung ausriefen, der wird jetzt ohne jede Romantik in die Normalität des Büroalltags zurückkatapultiert. Um "Co-Working Places" in wechselnden "Teamkonstellationen" geht es nicht. Es geht auch nicht um die "Home-Office"-Konzepte, Video- oder Skype-Konferenzen avancierter Unternehmen, die es den Angestellten erlauben, zu Hause zu bleiben. Es geht um Büros als Orte der Unfreiheit. Die meisten Menschen arbeiten genau da.
Was sind das also für Bücher? Gleich zwei Angestelltenromane stehen auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse. Es sieht in ihnen und auch sonst überhaupt nicht gut aus für die Angestellten: In Thomas von Steinaeckers "Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen, und anfing zu träumen" wird die Versicherungsvertreterin eines großen Münchner Unternehmens mitsamt ihrer ganzen Abteilung wegrationalisiert. Jens Sparschuhs "Im Kasten" lässt den dem Ordnungswahn verfallenen Mitarbeiter einer Firma für Auslagerungs- und Haushaltsordnungssysteme in eine Zwangsjacke stecken. Christoph Bartmann, Leiter des Goethe-Instituts in New York und "Angestellter aus Leidenschaft", wie er sich nennt, hat einen Essay über das "Leben im Büro" geschrieben, den er gut gelaunt mit dem Protokoll eines seiner Bürotage beginnt, um eine niederschmetternde Analyse des Büros von heute folgen zu lassen. Alain de Botton besucht in seinem Reportagebuch über die "Freuden und Mühen der Arbeit" ein Büro für Wirtschaftsprüfung, in dem der Arbeitsbeginn das "Aus für die Freiheit" bedeutet.
Und wie es aussieht, wird es so weitergehen: Gerade sitzt Ulrich Blumenbach an der Übersetzung des nachgelassenen Romanfragments von David Foster Wallace, "The Pale King", über den Alltag in einer Steuerbehörde der amerikanischen Provinz, deren fünfstöckige Fassade das Mosaik eines Einkommensteuererklärungsformulars zeigt; die Kästchen zum Ankreuzen dienen als Fenster. Im Juli schließlich soll Rainald Goetz' ungeduldig erwarteter "Johann Holtrop" erscheinen, laut Suhrkamp-Verlag ein Roman über einen Vorstandsvorsitzenden in Deutschland in den nuller Jahren, Herr über 80 000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von fast zwanzig Milliarden weltweit, den Egomanie, die Verachtung der Arbeit, die Verachtung der Gegenwart und die Verachtung des Rechts ins wirtschaftliche Aus und gesellschaftliche Nichts abstürzen lassen.
Es ist dabei sicher kein Zufall, dass es in diesen Büchern um Angestellte aus allen Etagen geht (selbst der Vorstandsvorsitzende ist ja ein Angestellter seines Unternehmens). Denn die Angestelltenkultur der Gegenwart hat sich in eine Kultur des Managertums verwandelt: "Aus Behörden sind Agenturen geworden und aus Beamten und Angestellten, zumindest auf dem Papier, unternehmerisch handelnde Subjekte", schreibt Christoph Bartmann. "Eines dieser Subjekte bin ich. Ich bin, ohne gefragt worden zu sein, zum Manager geworden. Wir alle sind Manager geworden."
Das bedeutet, dass es sich bei Menschen im Büro schon längst nicht mehr um eine fremdbestimmte Masse von Befehlsempfängern handelt, die pflichterfüllt abarbeitet, was ihnen aufgetragen wird. Die gibt es zwar auch noch. Sie gibt aber nicht den Ton an. Die neuen Angestellten sind "Virtuosen des Selbstmanagements, flexibel und hochmotiviert". Sie sind freiwillige Selbstoptimierer, denen ständig eine Zielvereinbarung mit sich selbst im Nacken sitzt. Sie steuern sich selbst, in aller Regel sogar gut, im Einklang mit den Zielen der Organisation, weil sie diese Ziele ja selbst formuliert und vereinbart und ihnen auf der anderen Seite des Verhandlungstisches selbst zugestimmt haben. "Kein autoritärer Chef nötigt uns, die Dinge zu tun, die wir tun, wir nötigen uns selbst", schreibt Christoph Bartmann in seinem lesenswerten Buch und endet mit einer brutalen Einsicht: "Nie waren wir so frei im Büro, und nie zuvor waren wir so dressiert."
Das verändert auch die Situation der Angestelltenliteratur. Die Bürogestalten, die die Literatur des neunzehnten und beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts hervorgebracht hat, bei Georg Kaiser, Robert Walser oder Fernando Pessoa, waren Männer ohne Qualitäten und Besonderheiten, Wesen ohne Botschaft, durch die alle Aufträge hindurchgingen. Es waren "Angestellte", die, wie Siegfried Kracauer es formuliert hat, "von sich nicht sprechen können" und deren Gesichtsfarbe man sich immer leitzordnergrau vorstellte.
Interessanterweise hieß das nicht, dass sie ohne subversives Potential und ohne Macht waren. Herman Melvilles Schreiber "Bartleby" führt das mit seinem berühmten Arbeitsverweigerungssatz "I wouldprefernot to", ich möchte lieber nicht, genauso vor wie Sekretärinnen, die entscheiden, wer zum Chef durchkommt und wer nicht - und darin an den Türhüter in Franz Kafkas Erzählung "Vor dem Gesetz" erinnern, bei dem man vergeblich um Einlass bittet: "Es ist möglich", heißt es da, "jetzt aber nicht." Und: "Wenn es dich so lockt, versuche, trotz meines Verbots hineinzugehen. Merke aber: Ich bin mächtig."
In der Büroliteratur der Gegenwart ist es genau umgekehrt: Renate Meißner, die Heldin der Selbstoptimierung aus Thomas von Steinaeckers Roman "Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen, und anfing zu träumen", stellvertretende Abteilungsleiterin im Versicherungskonzern CAVERE, 42 Jahre alt, die sich mit Medikamenten fit hält, in Statistiken oder Kausaldiagrammen aus Lebenslogikseminaren denkt und sich selbst Managerin nennt, trägt nicht grau, sondern Chanel und Salvatore Ferragamo. Sie weiß sich zu präsentieren und zu verkaufen, wie es Berater und Coaches Arbeitnehmern als unbedingtes Muss nahelegen. Jeden Tag schreibt sie sich eine E-Mail mit einer "Performance-Eigenevaluation", in der sie sich Punkte gibt. Dafür ist von Subversion keine Spur. Im Gegenteil. Innerhalb der Optimierungslogik würde sich eine Geste der Weigerung oder der Blockade ja gegen einen selbst richten. Die Devise lautet: Übererfüllung.
"Wie: Ende?", schreit sie in Steinaeckers Roman am Telefon deshalb ihren Kollegen an, der ihr mitteilt, dass die ganze Abteilung aufgelöst wird, Beschluss von ganz oben: "Haben sich verspekuliert, die Herren aus dem Vorstand. Mit faulen Papieren. Im schönen Amiland. Und wir dürfen das jetzt ausbaden." Renate Meißner ist völlig fassungslos. CAVERE ist seit zwölf Jahren ihr Zuhause. Sie meint CAVERE und sagt: wir. Sie sagt nicht: Wie geht es uns, sondern: Wie geht es uns noch besser. CAVERE hat einen Traum. Die Steigerung der Quartalszahlen. In ihrem 11-Quadratmeter-Büro hat auch sie diesen Traum geträumt. Warum sollte man jemanden, der alles immerzu so überrichtig gemacht hat, rausschmeißen?
Entweder wird man zum Opfer der Irren - oder man wird selbst irre: Das ist es, was uns die neuen Angestelltenromane erzählen. Irre wird der ordnungsbesessene Hannes Felix aus Jens Sparschuhs Roman "Im Kasten", Angestellter der Firma NOAH, was für "Neue Optimierte Auslagerungs- und Haushaltsordnungssysteme" steht. Sein Fall ist der einer pathologischen Pflichtübererfüllung. Manisch sucht er nach immer ausgefeilteren Strategien, sein Leben und die Dinge auch außerhalb der Arbeit so effizient wie möglich zu ordnen. Er ist sich sicher, dafür bald befördert zu werden. Stattdessen holen ihn die Psychiater. "Jetzt", denkt er, als er sich von einer großen, feierlichen Eskorte in den Hof begleitet fühlt, "ist endlich alles in Ordnung."
Und so schnell kommt man aus dieser Ordnung nicht wieder raus. Hat man das Optimierungs- und Evaluationssystem und die damit verbundene Formelsprache der neuen Büros einmal verinnerlicht, ist es kaum möglich, sie ohne weiteres wieder abzulegen. Genau darin bestehen ja der Terror und die Zurichtungen des Büros. Dass Thomas von Steinaecker Renate Meißner am Ende seines Romans weit weg nach Samara schickt, in einen Vergnügungspark, den er poetisch verklärt. Dass er sie dort ohne Tabletten schlafen, auch mal wieder weinen und mit der Hand statt am Computer schreiben lässt - all das ist wenig überzeugend, so kitschig wie der lange Titel seines Romans und droht die Schlagkraft seiner treffenden Büroweltanalyse beinahe wieder zu kassieren.
Denn man kann dem Terror kein Ende machen, indem man einfach wegfährt. Man kann auch nicht einfach das Internet oder Telefon abstellen, und alles ist gut. Darin besteht das Missverständnis der viel beschworenen Sehnsucht nach der Unerreichbarkeit, dem "Disconnectopia", nach der Auszeit, dem "Ich bin dann mal weg", jener temporären Flucht "aus dem Hamsterrad" und der Rolle vorwärts in eine sogenannte Spiritualität. Ob Asien oder Jakobsweg, Wellness-Spa oder Meditationskloster: Für Christoph Bartmann sind es therapeutische Gegen- und Parallelwelten, die das weitere Funktionieren der Bürowelt nur sichern. Dasselbe gilt seiner Ansicht nach für die Burnout-Klinik, wie er in einem eindrucksvollen Wutanfall über Miriam Meckels Buch "Brief an mein Leben" feststellt: "Die Burnout-Klinik, aus der heraus sie ihren Bestseller geschrieben hat, ist, wie das Kloster oder die Wellness-Oase, eine jener Außenstellen des Büros, in denen Büroteilnehmer ihre ausgebrannten Existenzen kurieren, ohne dabei sich oder anderen die Systemfrage stellen zu müssen."
Stellen wir also die Systemfrage. Stellen wir sie, zwischen den Angestelltenromanen und Bürobüchern dieses Frühjahrs, im Redaktionsbüro. Unserer Terrorzelle.
JULIA ENCKE.
Christoph Bartmann: "Leben im Büro. Die schöne neue Welt der Angestellten". Hanser, 320 Seiten, 18,90 Euro.
Alain de Botton: "Freuden und Mühen der Arbeit". S. Fischer, 352 Seiten, 19,99 Euro.
Jens Sparschuh: "Im Kasten". Roman. Kiepenheuer & Witsch, 224 Seiten, 18,99 Euro.
Thomas von Steinaecker: "Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen, und anfing zu träumen". Roman. S. Fischer, 399 Seiten, 19,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Eine brillante Gesellschaftssatire Der Roman zum "Ordnung ist das halbe Leben"-Prinzip Eine brillante Gesellschaftssatire Der Roman zum "Ordnung ist das halbe Leben"-Prinzip
»Die große Kunst von Jens Sparschuh liegt darin, mit Sprachwitz und Feingefühl einen sympathischen und hochneurotischen Don Quichotte von heute zu entwerfen [...].« Kulturkurier 20121030
Am Anfang konnte Rezensent Kolja Mensing noch lachen über Jens Sparschuhs Satire auf einen Mann im Ordnungswahn, der seine Kollegen im öffentlichen Dienst mit seinen Ideen zu Ablagesystemen und Rundmails so lange nervt, bis er gefeuert wird. Auch dass dieser Mann seiner Frau beim Auszug erklärt, sie brauche ein Kofferverzeichnis, hält Mensing für sehr witzig. Aber mit fortschreitender Lektüre hat ihn der aufgeräumte Witz dieses Buches doch ermüdet. Nie wird es richtig böse, Wortspiele und Kalauer reihen sich aneinander und schließlich, muss der Rezensent merken, greift Sparschuh auch noch zu Ikea-Witzen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH