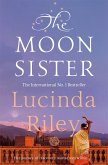Eine Meisternovelle, ein literarischer Coup - Maxim Biller erzählt eine Geschichte über den großen jüdischen Schriftsteller Bruno Schulz
Der 1942 ermordete jüdische Autor und Zeichner Bruno Schulz wird zur literarischen Hauptfigur in Maxim Billers neuem Buch - und zum Seismographen künftiger Katastrophen.
Maxim Biller ist mit dieser Novelle etwas Erstaunliches gelungen: Inspiriert von der osteuropäischen Erzähltradition eines Michail Bulgakow oder Isaac Bashevis Singer, nimmt er seine Leser in einem magischen, burlesken Text mit auf die Reise in die polnische Stadt Drohobycz, in die Welt des Schriftstellers Bruno Schulz und in das Jahr 1938. Er führt uns in einen Keller, in dem Bruno Schulz, der seinen Lebensunterhalt als Kunstlehrer verdient und vom literarischen Durchbruch in ganz Europa träumt, einen Brief an Thomas Mann schreibt. Er hofft, dass der weltberühmte Schriftsteller ihm helfen kann, im Ausland einen Verlag zu finden - dann würde er auch endlich einen Grund haben, seine Heimat für immer verlassen. Denn die Zeichen des kommenden Unheils sind unübersehbar und nähren seinen ständigen Begleiter, die Angst. Im Kopf von Bruno Schulz entsteht eine apokalyptische Vision, die vorwegnimmt, was kurz darauf im besetzten Polen tatsächlich passieren wird. Und es entsteht ein literarisches Kunstwerk, brillant geschrieben, voll von schwarzem Humor.
»Billers Sprache ist eine Melodie, die einen anweht, als lebte Albert Camus noch, als schriebe Gottfried Benn plötzlich Short Stories, als klopfte der Existentialismus aus seinem Grab zu uns herüber ...Biller ist ein großer Erzähler.« (Welt am Sonntag)
»Biller ist ein phantastischer Geschichtenfinder altmodischer Pracht, dem an der Welt gelegen ist, an der Wahrheit, am Leben.« (FAS)
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Der 1942 ermordete jüdische Autor und Zeichner Bruno Schulz wird zur literarischen Hauptfigur in Maxim Billers neuem Buch - und zum Seismographen künftiger Katastrophen.
Maxim Biller ist mit dieser Novelle etwas Erstaunliches gelungen: Inspiriert von der osteuropäischen Erzähltradition eines Michail Bulgakow oder Isaac Bashevis Singer, nimmt er seine Leser in einem magischen, burlesken Text mit auf die Reise in die polnische Stadt Drohobycz, in die Welt des Schriftstellers Bruno Schulz und in das Jahr 1938. Er führt uns in einen Keller, in dem Bruno Schulz, der seinen Lebensunterhalt als Kunstlehrer verdient und vom literarischen Durchbruch in ganz Europa träumt, einen Brief an Thomas Mann schreibt. Er hofft, dass der weltberühmte Schriftsteller ihm helfen kann, im Ausland einen Verlag zu finden - dann würde er auch endlich einen Grund haben, seine Heimat für immer verlassen. Denn die Zeichen des kommenden Unheils sind unübersehbar und nähren seinen ständigen Begleiter, die Angst. Im Kopf von Bruno Schulz entsteht eine apokalyptische Vision, die vorwegnimmt, was kurz darauf im besetzten Polen tatsächlich passieren wird. Und es entsteht ein literarisches Kunstwerk, brillant geschrieben, voll von schwarzem Humor.
»Billers Sprache ist eine Melodie, die einen anweht, als lebte Albert Camus noch, als schriebe Gottfried Benn plötzlich Short Stories, als klopfte der Existentialismus aus seinem Grab zu uns herüber ...Biller ist ein großer Erzähler.« (Welt am Sonntag)
»Biller ist ein phantastischer Geschichtenfinder altmodischer Pracht, dem an der Welt gelegen ist, an der Wahrheit, am Leben.« (FAS)
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Maxim Biller begibt sich mit seiner Novelle "Im Kopf von Bruno Schulz" auf die Spur eines der größten und tragischsten jüdischen Schriftsteller.
Von Michael Krüger
Wer noch nie Bruno Schulz gelesen hat, diesen jüdischen Meister der euphorischen Metapher aus dem galizischen Drohobycz, der darf sich auf die schönsten Lesestunden freuen. Das erhaltene Werk ist schmal. Neben den seinen Ruhm begründenden autobiographischen Erzählungen "Die Zimtläden" (1933 erschienen) und der Sammlung verstreuter Geschichten, "Das Sanatorium zur Sanduhr", sind nur einige Aufsätze, Kritiken und Briefe erhalten, der Rest muss als verschollen gelten - auch wenn die hartnäckigen Schulz-Verehrer immer noch daran glauben, eines Tages auf einem staubigen ukrainischen Dachboden eine Mappe mit dem gelegentlich erwähnten Manuskript des Romans "Der Messias" zu finden. Schulz hat sie, dafür gibt es verlässliche Zeugen, bei Freunden versteckt. Sind die Seiten verbrannt oder ganz einfach als Einwickelpapier verwendet worden? Es wäre der theologischen Erwartung auch fast zu viel, wenn nun, nach dem Holocaust, ausgerechnet der "Messias" noch einmal in Drohobycz auftauchen würde.
Die reiche, bilderreiche Sprache, mit der Bruno Schulz in allen dunklen Farben die damals triste Kreisstadt beschrieb, in der er eine ungeliebte Stelle als Kunstlehrer versah, wird einem nicht mehr aus dem Kopf gehen: "Unsere Stadt fiel schon damals immer mehr dem chronischen Grau der Dämmerung anheim, an ihren Rändern wuchsen Schattenflechten, flaumiger Schimmel und eisenfarbenes Moos."
In einem deutsch geschriebenen Exposé über die "Zimtläden", das Schulz in der Hoffnung verfasste, damit italienische Verlage für sein Werk zu interessieren, formuliert er die tieferen Absichten seines Schreibens und entwickelt gleichsam aus der Hand seine Poetologie. Darin heißt es: "Der Verfasser ist von dem Gefühl ausgegangen, dass die tiefsten Gründe einer Biographie, die letzte Form eines Schicksals gar nicht durch die Schilderung eines äußeren Lebenslaufes, noch durch eine noch so tief geführte psychologische Analyse erschöpft werden könne. Diese letzten Gegebenheiten des menschlichen Lebens lägen vielmehr in ganz anderer geistigen Dimension, nicht in der Kategorie des Faktischen, sondern in der des geistigen Sinnes. Ein Lebenslauf aber, der auf seine eigene Sinnesdeutung hinaus will, der auf seine eigene geistige Bedeutung zugespitzt ist, ist nichts anderes als Mythus.
Jene dunkle, ahnungsvolle Atmosphäre, jene Aura, die sich um jede Familiengeschichte zusammendrängt und in der es gleichsam mythisch wetterleuchtet, als ob in ihr das letzte Geheimnis des Blutes und des Geschlechtes enthalten wäre - erschließt dem Dichter den Zugang zu diesem zweiten Gesicht, zu dieser Alternative, dieser tieferen Version der Geschichte."
Bruno Schulz war eben alles andere als ein naiver Autor, der das bunte jüdische Treiben der Händler und Handwerker auf den Straßen von Drohobycz mit den artistischen Erfindungen seiner Sprache folkloristisch überhöhte. Ihm war es sehr ernst in seinem "Streben nach der absoluten Vollendung", um die "verlorene Sache der Poesie" vielleicht doch noch zu retten. Er war einer der letzten in der langen Reihe der jüdischen Künstler und Intellektuellen, die seit 1750 versuchten, ihr galizisches Schtetl zu verlassen, um in einer der Hauptstädte Mitteleuropas, in Prag, Budapest oder Wien, ihre Karriere als gleichberechtigte Bürger zu vollenden. Bruno Schulz, dieser sanftmütige Ästhet, wurde auf offener Straße von einem deutschen Gestapo-Mann erschossen.
Wer sich mit dem Leben dieses galizischen Unglücksraben beschäftigen will, wie es Maxim Biller jetzt mit seiner Novelle "Im Kopf von Bruno Schulz" tut, der muss sich auf eine bittere Reise gefasst machen. Nichts wollte Schulz gelingen. Die endlosen, kafkaesken Schreiben an die Schulbehörden, ihm eine feste Stelle zu geben, und später, als er sie endlich hatte, ein bezahltes Freijahr, die Bitte um Versetzung nach Warschau, wo die polnische Avantgarde um seine Freunde Gombrowicz, Tuwim und Witkiewicz gerade Aufmerksamkeit erregte, und schließlich die Bitte um Urlaub, um seine angeschlagene Gesundheit zu kurieren - diese Schreiben brechen einem das Herz, denn sie waren alle - vergeblich. Im Jahre 1932 muss er auf der Konferenz für Handarbeitslehrer in Stryj - wo ein Jahr später Louis Begley als Ludwig Beglejter auf die Welt kam - einen Vortrag zum Thema "Die künstlerische Formgebung in Pappe und ihre Anwendung in der Schule" halten: für den bedeutenden Graphiker und Radierer Schulz eine Tortur. Immer kam etwas dazwischen, immer wurde er unterbrochen, nie war es ihm gestattet, kontinuierlich an seinem Werk zu arbeiten.
Die Versuche, seine Geschichten in Übersetzungen herauszubringen, scheiterten trotz der Fürsprache so prominenter Zeitgenossen wie Joseph Roth. Schulz schreibt sogar eine Geschichte in deutscher Sprache, "Die Heimkehr", die aber auch keinen Verleger fand und seither als verloren gilt. Schließlich unternimmt er im August 1938 - mit fast allen seinen Zeichnungen im Gepäck - eine abenteuerliche Reise rund um das faschistische Deutschland nach Paris, weil er dort Anerkennung erhoffte. Und Schutz vor der deutschen Entwicklung, denn inzwischen waren der Anschluss Österreichs erfolgt und die Besetzung der Tschechoslowakei. Doch die Pariser befanden sich in der Sommerfrische, keiner hatte Zeit für den korrekt gekleideten kleinen Mann aus Galizien mit der Rolle seiner Zeichnungen unter dem Arm.
Die nun folgende Geschichte vom Ausbruch des Krieges, vom Überfall auf Polen und von der sofort einsetzenden Verfolgung und brutalen Tötung von Juden, auch in Drohobycz, von der Besetzung durch sowjetische Truppen und dem stalinistischen Terror, von der Zurückweisung seiner Erzählungen mit der Begründung: "Wir brauchen keine Prousts!", von der deutschen Besetzung seiner Heimatstadt im Juni 1941 bis zum bitteren Ende - diese deutsche Geschichte ist zu furchtbar, um sie hier zu wiederholen. Auf jeden Fall darf der Jude Bruno Schulz in seiner Heimatstadt nicht mehr auf dem Gehsteig gehen oder in arischen Krankenhäusern behandelt werden; die jüdischen Waisenkinder werden als unnötige Esser gleich mit den Erzieherinnen erschossen.
Am 19. November 1942 feuert der SS-Scharführer Karl Günther zwei Schüsse auf Bruno Schulz ab, die ihn auf der Stelle töten. Der Mörder brüstet sich damit, den Schützling eines anderen brutalen Mörders, des SS-Manns Felix Landau aus Wien, für dessen Kinder der Maler Schulz für einen Teller Suppe die Zimmer mit Fresken versehen hat, erschossen zu haben. Es ist und bleibt eine der widerlichsten Geschichten des langen, überlangen zwanzigsten Jahrhunderts.
Es ist bezeugt, dass Bruno Schulz 1938/39 mehrere Briefe an Thomas Mann schrieb, dessen Josephs-Roman er verehrte; auch seine deutsch geschriebene Novelle legte er bei. Es soll tatsächlich eine Antwort von Thomas Mann gegeben haben, die allerdings wie der größte Teil der umfangreichen Korrespondenz von Bruno Schulz nie wieder aufgetaucht ist.
Wie mag wohl ein im Westen vollkommen unbekannter jüdischer Schriftsteller aus Drohobycz an den Nobelpreisträger Thomas Mann geschrieben haben? Maxim Biller versucht in seiner Novelle diese Frage zu beantworten. Nach mehreren seriösen Versuchen schreibt sein Bruno Schulz: "Lieber Dr. Thomas Mann! Obwohl wir uns nicht persönlich kennen, muß ich Sie darüber informieren, daß vor drei Wochen ein Deutscher in unsere Stadt gekommen ist, der behauptet, Sie zu sein. Da ich Sie - wie wir alle in Drohobycz - nur von Fotografien aus den Zeitungen kenne, kann ich nicht mit letzter Sicherheit sagen, daß Sie es nicht sind, aber allein die Geschichten, die er erzählt - von seiner abgetragenen Kleidung und dem starken Körpergeruch abgesehen, der ihn umgibt -, machen ihn verdächtig."
Maxim Biller kriecht gleichsam in den Körper von Bruno Schulz, um aus dieser Innenperspektive dessen bedrückende Lebensumstände genau zu erfassen. Schulz hockt in seinem Arbeitszimmer in der Florianska 10 im Keller, um ihn herum die ausgestopften Vögel, die in seinen Erzählungen eine bedeutende Rolle spielen und bei Biller bald zu sprechen beginnen, an den nassen Wänden seine welligen Zeichnungen mit sadomasochistischen Motiven und in jeder Ecke ein dicker Klumpen Angst, der sein Schreiben argwöhnisch verfolgt: "Du mußt zur Sache kommen", flüstert die Angst, "weißt du, wie viele Briefe er jeden Tag bekommt?"
Die "Sache" ist natürlich, dass der falsche Thomas Mann eine Art Spion ist und die Juden von Drohobycz ausspionieren soll vor ihrer Vernichtung. "Es ist wirklich sehr unangenehm, daß die Nazi Ihren guten Namen benutzen, sehr verehrter Dr. Mann", schreibt Bruno Schulz bei Biller an Thomas Mann, "und weil Sie als Stimme des anderen Deutschlands auf Ihren Ruf achten müssen, wollte ich Sie warnen."
Bruno schließt den Brief mit "Hochachtungsvoll, Ihr sehr trauriger und sehr ergebener Bruno Schulz", steckt ihn in ein Couvert und kriecht "auf allen vieren", aus dem Haus, um in seine Schule zu kommen. "Er war, obwohl schon fast eine Stunde unterwegs, gerade erst beim Portikus des Stadtparks angekommen, er atmete schwer, seine Knie waren wund und blutig, und die Tauben im Himmel über Drohobycz flogen eine nach der anderen in den roten Feuerschein hinein, wo sie wie Zunder verbrannten."
Man muss die Werke von Bruno Schulz kennen, um die vielen Anspielungen und Echos zu verstehen, die in dem Text von Maxim Biller versteckt sind und ihm seinen Ton geben. Vielleicht war das ja der geheime Antrieb des Autors: Lest Schulz!
Und natürlich hofft man als Leser von Maxim Billers Novelle, dass das Thomas-Mann-Archiv tatsächlich so schlecht ist wie sein Ruf, damit das Original des Briefes von Bruno Schulz zusammen mit seiner deutschen Erzählung doch noch die Welt jenseits von Drohobycz erreicht.
Michael Krüger ist Lyriker, Übersetzer und Geschäftsführer des Hanser-Verlags, in dem das literarische Werk von Bruno Schulz erscheint.
Maxim Biller:
"Im Kopf von
Bruno Schulz". Eine Erzählung.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2013. 71 S., geb., 16,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Beatrice Eichmann-Leutenegger schätzt Maxim Billers Novelle über den jüdischen Schriftsteller und Maler Bruno Schulz, der 1941 von einem Gestapo-Mann erschossen wurde. Billers Unterfangen, sich in den den "Kopf von Bruno Schulz" hineinzuversetzen und ihn an Thomas Mann schreiben zu lassen, scheint ihr ein gewagtes, aber letztlich gelungenes Spiel mit Motiven, Figuren, Stimmungen des Bruno Schulz. Dabei hebt sie hervor, dass Biller sich nicht auf die Realitäten in Schulz' Leben beschränkt, sondern auch surreale Momente einbezieht, etwa wenn zwei Tauben beginnen zu Schulz zu sprechen. Verdienstvoll an der vorliegenden Novelle scheint Eichmann-Leutenegger schließlich, dass sie neugierig auf Bruno Schulz und dessen Werk macht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Biller schreibt mit einer selbstverständlichen, unaufdringlichen Eleganz, mit der sich kein anderer der deutschsprachigen Schriftsteller seiner Generation messen kann. Seine Novelle erreicht weltliterarisches Niveau.« Sebastian Hammelehle spiegel.de 20131107