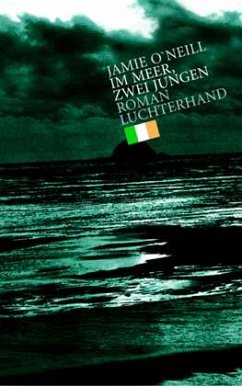In einem Vorort von Dublin hält Mr. Mack, Inhaber eines Krämerladens, ein wachsames Auge auf seine Umgebung. Schließlich sind die Slums nicht weit, und eine Familie im Aufwind, wie die Macks es sind, kann nicht vorsichtig genug sein. Kämpft nicht sein älterer Sohn auf dem Kontinent gegen die Deutschen, wie einst er gegen die Buren zog? Und dann Jim, sein Jüngerer, ein richtiger Gelehrter könnte aus ihm werden ...
Jamie O'Neill gelingt es, die ganze Komplexität und Tragik der irischen Geschichte im Leben einer Handvoll Figuren zu konzentrieren und lebendig zu machen.
Jamie O'Neill gelingt es, die ganze Komplexität und Tragik der irischen Geschichte im Leben einer Handvoll Figuren zu konzentrieren und lebendig zu machen.

Jamie O'Neill bringt der irischen Moderne die Flötentöne bei
Auf der vorletzten Seite dieses mit viel Langmut geschriebenen Romans erlaubt sich der Autor einen kleinen Witz. Wir zählen die Seite 702, der Morgen weht bereits durch die Vorhänge, und Jim Mack träumt noch einmal von seinem Freund, dem Doyler Doyle. Jim und Doyler - Doyler und Jim: Die Reihenfolge ist ganz egal - sind die jugendlichen Helden von Jamie O'Neills Roman; gemeinsam springen sie gegen Ende verliebt über den Rasen. "Kennst du die Geschichte von meiner kleinen Nichte?" fragt Doyler den Träumer Jim, und hier kommt der gereimte Witz: "Sie ging aus dem Haus. Und jetzt ist die Geschichte aus." Doylers triumphierendes Grinsen - "Oh, dieses Grinsen" - gilt dabei nicht allein dem Freund, sondern auch dem übernächtigten Leser, denn "Im Meer, zwei Jungen" ist bei allem Lob, das man diesem ambitionierten Roman zollen muß, stellenweise doch zu ausführlich geraten, und der Autor tut nichts, um dies zu verbergen. Nach zehn Jahren Arbeit an seinem Buch war die Sehnsucht nach einer schneller zu Ende gebrachten Geschichte vermutlich sehr groß.
Am Anfang - in Glasthule, einer Kleinstadt "am Saume der Bucht von Dublin", wir schreiben das Jahr 1915 - steht Jims Vater an einer Straßenecke am Zeitungsstand und kauft eine "Irish Times". Die Zeitung ist doppelt so teuer wie jedes andere Blatt, aber Mr. Mack, "der Gockel der Stadt", läßt sich seinen Ruf gelegentlich gern etwas kosten. Mr. Mack ist der stolze Besitzer der ortsansässigen Gemischtwarenhandlung - "oh, immer im Aufwind, das ist Mr. Mack, ein christlicher illustriger viktualischer Mann". Sein älterer Sohn Gordon zieht für König und Vaterland in den Krieg, der sechzehnjährige Jim besucht als feinsinniger Stipendiat das katholische Presentation College. Es könnte ihm nicht besser gehen, diesem Mr. Mack: Seine Naivität zeichnet Jamie O'Neill mit sanfter Feder.
"Im Meer, zwei Jungen", der dritte Roman des 1962 in Dublin geborenen Autors, spielt vor dem Hintergrund der politischen Unruhen, die am Ostermontag 1916 schließlich in die Besetzung des Dubliner Hauptpostamts durch irische Nationalisten und die blutige Niederschlagung des Aufstands durch britische Truppen mündeten. O'Neill erzählt allerdings keinen konventionellen historischen Roman, in dem das politische Ambiente dieses Augenblicks en détail wiederauflebte; die Protagonisten des Easter Rising - anders als beispielsweise in Roddy Doyles "Henry der Held", in dem der Autor seine Romanfigur sehr viel näher an den politischen Kern der Sache vordringen läßt - bleiben weitgehend am Rande des Geschehens. O'Neill ist vielmehr ein Meister der Anspielung, seine Stärke liegt in der Distanz, die er geduldig zu halten versteht, bevor er Motive miteinander verknüpft und die verschiedenen Ebenen seiner Erzählung aneinander heranführt.
Als Doyler Doyle, der Sohn von Mr. Macks ehemaligem Kameraden Mick, nach Jahren, die er auf dem Land verbrachte, in die Kleinstadt zurückkehrt, ist der Osteraufstand scheinbar noch in weiter Ferne und Doyler in Mr. Macks Augen vor allem ein Bengel aus den Slums, in die seine Familie inzwischen hinabgesunken ist. Doyler und Jim besuchten einst gemeinsam die Volksschule; als sie sich an Jims sechzehnten Geburtstag nach Jahren zum erstenmal wiedersehen, trägt Jim noch kurze Hosen, während der muskulöse Doyler als Bursche des Fuhrmanns den Mist wegkarrt und sich am Forty Foot, der "Badestelle für Herren", hingebungsvoll schon mal ein Silberstück verdient.
Die zwei Jungen könnten auf den ersten Blick nicht verschiedener sein, und ihre gegensätzlichen Temperamente scheinen der Erneuerung ihrer unvergessenen Freundschaft inzwischen ebenso im Weg zu stehen wie das Klassenbewußtsein von Mr. Mack. Nachdem ihm ein großzügiger Gentleman allerdings die paar Shilling überlassen hat, mit denen er seine verpfändete Studierflöte zurückkaufen kann, tritt Doyler dem Spielmannszug bei, in dem auch Jim flötet: Anthony MacMurrough, der Neffe der formidablen Herrin von Ballygihen House, deren Vater man im "heiligen Irland" noch Jahre nach seinem Tod patriotische Balladen singt, wird auf diese Weise ganz beiläufig zum Stifter einer sich mit großer Behutsamkeit vorantastenden Liebe. Als Homosexueller, der nach dem Verbüßen einer mehrjährigen Gefängnisstrafe - gewissermaßen nach dem Vorbild Oscar Wildes, den er mit Vorliebe zitiert - um die bigotte Scheinmoral der bürgerlichen Gesellschaft weiß, ist MacMurrough die tragische Mittlerfigur, die Jim und Doyler den gemeinsamen Weg bahnt und O'Neills Roman zusammenhält.
Durch "Two Boys, At Swim" - so der Originaltitel - weht nicht allein aufgrund der präzisen zeitgeschichtlichen Verankerung der Geist der irischen Revolution: Bereits der Titel ist eine Verbeugung vor "At Swim - Two Birds", Flann O'Briens Glanzstück der irischen Moderne. Der "Ulysses" schließlich ist der überragende literarische Leuchtturm, an dem sich O'Neill selbstbewußt orientiert. Mr. Mack kommt wie ein verlorengegangener Bruder des liebenswerten Kleinbürgers Leopold Bloom daher; der Martello-Turm nahe der Badestelle am Forty Foot, von wo aus Doyler und Jim am Ostersonntag 1916 zu den Felsen der Muglins hinausschwimmen, um die irische Fahne zu hissen und sich endlich auch ihrer Körper zu ergeben, kommt auch im "Ulysses" schon auf der ersten Seite vor.
Das unablässige Echo, das derart klangvoll durch O'Neills Romanwerk hallt, verschafft der eigenen Stimme des Autors dabei jedoch nicht immer Gehör. O'Neill delektiert sich an vorbildlich komponierten Rhythmen - "A porcelain shepherdess proffered tiny sugared treats on a tray, offered them twice" -, denen Hans-Christian Oeser in seiner hervorragenden Übersetzung aber glücklicherweise nicht zwanghaft folgt - "Auf einem Tablett bot eine Porzellanschäferin winzige Naschereien an, und zwar gleich zweimal" -, und bettet seine jungen Helden auf die weichen Kissen einer Poesie, deren zum Teil erdrückende Bildhaftigkeit James Joyce zu Beginn des 21. Jahrhunderts vermutlich ordentlich aufgemischt hätte.
Eine in dieser Hinsicht etwas maßvollere Ausstattung hätte O'Neills Roman sicher nicht geschadet und ihn auf ein handlicheres Format zurückschrumpfen lassen, das dem Leser dann stellenweise vielleicht weniger Ausdauer abverlangt hätte. Naturgemäß jongliert O'Neill auch mit allen seit Joyce mehr oder minder gebräuchlichen Perspektivwechseln und führt Alltags- und Traumwelten eng zusammen. Der Wagemut, mit dem der Autor hier vielschichtig den irischen Geist beschwört, die draufgängerische Art und Weise, mit der er das reiche Erbe der Tradition ohne die geringste Scham für seine Helden Doyler und Jim beansprucht, bleibt dem Autor hoffentlich auch für seinen nächsten Roman erhalten.
THOMAS DAVID
Jamie O'Neill: "Im Meer, zwei Jungen". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Hans-Christian Oeser. Luchterhand Literaturverlag, München 2003. 703 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Uwe Pralle jubelt: das neueste Werk von Jamie O'Neill sei kein Roman, wie er alle Jahre, "sondern allenfalls einmal alle zehn Jahre entsteht". Die im Schatten des aufziehenden Ersten Weltkriegs in Irland spielende Dreiecksgeschichte zwischen zwei Sechzehnjährigen und einem alternden Päderasten hat ihm ausgesprochen gut gefallen. O'Neill beschreibe die homosexuelle Liebe zwar einerseits "drastisch", sein Protagonist MacEmm könne es aber an "scharfzüngiger Kultiviertheit und Lüsternheit fast mit seinem Idol Oscar Wilde aufnehmen". Auch der historische Hintergrund, der Dubliner Osteraufstand von 1916, werde mit ausreichender Distanz geschildert, lobt der Rezensent. "Wunderbar" ist seiner Meinung nach zudem der "Sprach- und Melodienreichtum" dieses "eigenen literarischen Kosmos", unterstützt durch die "makellose" Übersetzung.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH