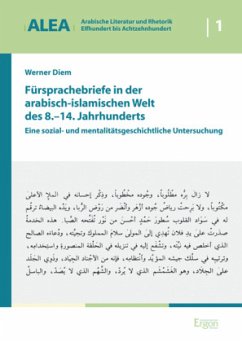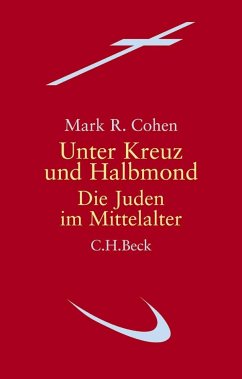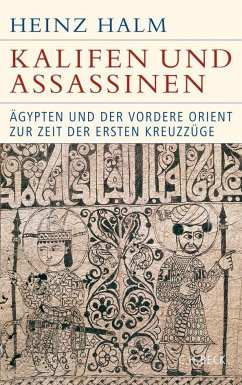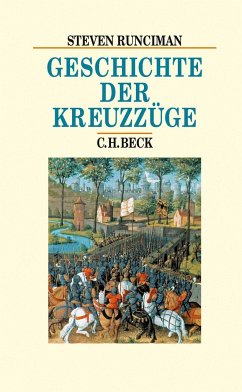Nicht lieferbar
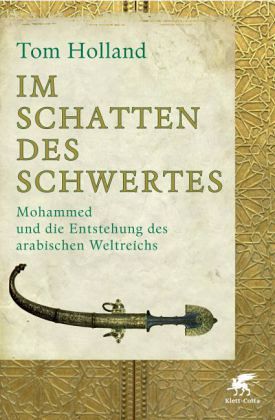
Im Schatten des Schwertes
Mohammed und die Entstehung des arabischen Weltreichs
Übersetzung: Held, Susanne
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Tom Holland erzählt den erstaunlichen Aufstieg der Araber im 7. und 8. Jahrhundert n. Chr. zu einer imperialen Macht. Mit stilistischer Brillanz und mit historischem Scharfsinn schildert er die ungeheure Dynamik, mit der der Islam in religiös-politischen Konflikten mit Juden und Christen die antike Welt von Grund auf veränderte.Niemand ahnte um die Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert, dass die Araber eine weltgeschichtliche Revolution herbeiführen würden. Ausgehend von den legendenumrankten Lebensbeschreibungen des Propheten, schildert der Autor das politische Wirken Mohammeds und der Kalifen...
Tom Holland erzählt den erstaunlichen Aufstieg der Araber im 7. und 8. Jahrhundert n. Chr. zu einer imperialen Macht. Mit stilistischer Brillanz und mit historischem Scharfsinn schildert er die ungeheure Dynamik, mit der der Islam in religiös-politischen Konflikten mit Juden und Christen die antike Welt von Grund auf veränderte.
Niemand ahnte um die Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert, dass die Araber eine weltgeschichtliche Revolution herbeiführen würden. Ausgehend von den legendenumrankten Lebensbeschreibungen des Propheten, schildert der Autor das politische Wirken Mohammeds und der Kalifen bis zur Gründung Bagdads im Jahre 762. Im Zentrum stehen die geistig-politischen Umwälzungen und die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Großmächten der damaligen Zeit. Zugleich spürt er den tiefer liegenden Gründen nach, warum und wie Mohammeds Offenbarungen in einem abgelegenen Winkel der damaligen Welt und seine unbedingte Forderung nach einer Unterwerfung unter Allah der menschlichen Zivilisation ein neues Gesicht gaben.
Niemand ahnte um die Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert, dass die Araber eine weltgeschichtliche Revolution herbeiführen würden. Ausgehend von den legendenumrankten Lebensbeschreibungen des Propheten, schildert der Autor das politische Wirken Mohammeds und der Kalifen bis zur Gründung Bagdads im Jahre 762. Im Zentrum stehen die geistig-politischen Umwälzungen und die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Großmächten der damaligen Zeit. Zugleich spürt er den tiefer liegenden Gründen nach, warum und wie Mohammeds Offenbarungen in einem abgelegenen Winkel der damaligen Welt und seine unbedingte Forderung nach einer Unterwerfung unter Allah der menschlichen Zivilisation ein neues Gesicht gaben.