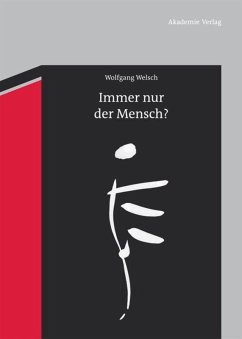Fast 25 Jahre nach seinem Bestseller 'Unsere postmoderne Moderne' legt Wolfgang Welsch eine neuartige und tiefer gehende Infragestellung der Moderne vor. Als zentral für die Moderne sieht er das anthropische Prinzip an: In allem ist vom Menschen auszugehen, alles ist auf den Menschen zu beziehen; der Mensch ist das Maß der Welt, die Welt ist Menschenwelt - und nichts sonst, nichts darüber hinaus.
Dem stellt er kritisch eine Reihe von Phänomenanalysen und die Skizze einer Anthropologie auf evolutionärer Grundlage entgegen. Indem nicht die Welt vom Menschen her, sondern zuerst einmal der Mensch von der Welt her zu begreifen ist, ist den anthropischen Spiegelspielen der Moderne der Boden entzogen, und eine neue Denklandschaft zeichnet sich ab.
Dem stellt er kritisch eine Reihe von Phänomenanalysen und die Skizze einer Anthropologie auf evolutionärer Grundlage entgegen. Indem nicht die Welt vom Menschen her, sondern zuerst einmal der Mensch von der Welt her zu begreifen ist, ist den anthropischen Spiegelspielen der Moderne der Boden entzogen, und eine neue Denklandschaft zeichnet sich ab.