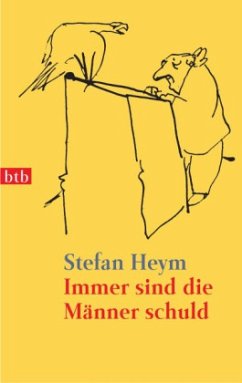Über weiblichen Instinkt, männliche Schuldgefühle und das Wunder einer Liebe, die im Alter jung geblieben ist - Stefan Heyms letzter Erzählband ist eine Liebeserklärung an seine Frau und an das Leben. Selbstironisch, heiter und voller Zärtlichkeit schreibt Heym über die Ehe und das Altern. Kongenial ergänzt mit Zeichnungen von Horst Hussel.

Szenen einer Ehe: Stefan Heyms nachgelassenes Geschichtsgeschenk
Halsband, Ring und Hut hatte die Gemahlin schon. Nach dreißig Ehejahren kann man das auch erwarten. Weil Stefan Heym nicht wußte, was er seiner Frau zum Geburtstag schenken sollte, schrieb er ihr Geschichten. Unter dem Titel "Immer sind die Weiber weg" sind sie 1997 erschienen und wurden zum letzten großen Bucherfolg Stefan Heyms, der im Dezember 2001 während einer Reise nach Israel starb. Im Nachlaß fanden sich weitere an diese Sammlung anknüpfende Erzählungen, die den komplementären Titel "Immer sind die Männer schuld" trugen. Erneut handelt es sich um heitere Szenen einer Ehe, in der im Lauf der Jahrzehnte Zank und Zetern zur spezifischen Form der Zärtlichkeit herangereift ist.
Mit subtiler Ironie schildert Heym die eigene Altersschrulligkeit, seine Nöte mit vergessener Pin-Nummer vor dem Bankautomaten, mit den Krümeln unterm Frühstückstisch oder mit den neu eingebauten Sicherheitsschlössern an der Terrassentür. Gelassen spricht er von der Hinfälligkeit des Körpers und den Schmerzen, die ein Sturz auf der Treppe verursacht, wo er wie ein Käfer auf dem Rücken liegt und mit den Beinchen strampelt. Doch jede dieser Alltagsepisoden dient eigentlich nur dazu, Liebe und Zuneigung zu "seinem Weib" zu schildern und die abenteuerlichen Verrenkungen zu untersuchen, die daraus resultieren. Die Abhängigkeit der Eheleute voneinander tarnt sich immer wieder als Verärgerung, die den Anschein von Autonomie entstehen läßt. Denn Rettung, das ist klar, bringt nur sie, die die Dinge und die Tage zu ordnen versteht.
Weil die Geschichten ursprünglich Geschenke waren und erst in zweiter Instanz zur Veröffentlichung bestimmt, hat Stefan Heym dafür die intime Privatsprache der Liebenden benutzt. Es ist eine Kunstsprache, die dem Jiddischen nachempfunden ist und damit auf die jüdische Herkunft Stefan Heyms verweist. Das gelingt ihm vor allem durch eine eigenwillige Syntax mit gewagten grammatikalischen Kurven und Verschlingungen, die sich zum Klagegesang oder zum Spottlied erheben können. Jiddisch hat er in den Jahren des amerikanischen Exils in einer Druckerei in New York gelernt. In der nachgelassenen Prosa ist davon eher der Sound als die Sprache übriggeblieben. Das klingt dann so: "Also hab ich mich getragen wie ein großer Held ein moralischer und hab versteckt mein Leid und weggedrängt meine Bedrängnis aus meinem Bewußtsein wenn ich hab gehabt Leid und Bedrängnis, und natürlich hab ich gehabt Leid und Bedrängnis genug, und wenn ich sie sollte mal nicht gehabt haben hab ich sie mir selber gemacht und mit eigener Hand und mit meinem eigenen Geist."
Dieser Tonfall, niedlich und nervig zugleich, zieht sich durch das ganze Buch. Er funktioniert an den Stellen, an denen es gilt, das Kleine, das Alltägliche, das Intime zu erfassen. Peinlich wird es jedoch dann, wenn Heym sich im selben Duktus der Sphäre der Politik nähert und den Tag schildert, an dem er als parteiloser Kandidat der PDS und Alterspräsident des Bundestages die Eröffnungsrede im Parlament zu halten hatte. Mit Stasi-Gerüchten hatten CDU-Vertreter zuvor versucht, den alten Sozialisten zu diskreditieren, der in der DDR stets zu den mutigen Opponenten gehört hatte. Während seiner Rede verließen sie den Saal oder wandten sich demonstrativ ab: zweifellos ein Tiefpunkt in der Geschichte des deutschen Parlaments.
Heym gab nun leider dem Bedürfnis nach, die Dinge letztgültig zurechtzurücken und hebt so an: "Also, Kinder, ich werd euch die Geschichte von der großen Rede erzählen und wie ich sie doch geredet hab trotz allem und allem und allem." Dieser Text hätte vielleicht besser in Doris Schröder-Köpfs Kinder-Politikfibel "Der Kanzler wohnt im Swimmingpool" gepaßt, als in einen literarischen Erzählungsband. Andere, bescheidenere Geschichten sind eher gelungen. "Immer sind die Männer schuld" ist, wie auch schon der Vorläufer "Immer sind die Weiber weg", großzügig gesetzt und mit Zeichnungen von Horst Hussel illustriert. So ist aus den Geschenktexten Stefan Heyms für seine Frau Inge ein hübsches, harmloses Geschenkbuch für jedermann und jedefrau geworden.
JÖRG MAGENAU
Stefan Heym: "Immer sind die Männer schuld". Erzählungen. Verlag C. Bertelsmann, München 2002. 222 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main