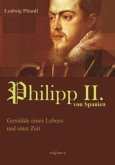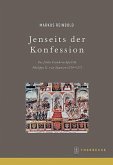Herrschaft - so hieß es am Spanischen Hof des 16. Jahrhunderts - muss auf 'vollständiger Kenntnis' beruhen. Um die Territorien der Neuen Welt aus der Distanz regieren zu können, setzte man deshalb Papier und Karten, Kosmographen und Bürokraten ein. Man wollte ein Weltreich auf Information und Beobachtung, ein Imperium auf Empirie gründen. Die Untersuchung dieses kühnen Vorhabens zeigt indes, weshalb 'vollständige Kenntnis' permanent versprochen, aber doch nie erreicht wurde: Das Postulat, alles zu wissen, war Teil der herrschaftlichen Rhetorik und die Aufrufe, objektive Informationen an den Hof zu senden, wurden zu einer willkommenen Gelegenheit für jedermann, seine eigenen Interessen ins Spiel zu bringen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Die Empirie kam mit der Macht: Philipp II. als Initiator einer gewaltigen kosmographischen Datenbank
Als in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts der Kronjurist Juan de Ovando auf Geheiß seines Herrn, des spanischen Königs, die Amtsführung des Indienrates unter die Lupe nahm, packte ihn das kalte Grausen. Unfassbar war die Ignoranz, die seine Visitation zutage förderte. Die für die Administration der Angelegenheiten in Übersee zuständigen Zentralinstanzen hatten offenkundig überhaupt keine Ahnung von den Territorien, die ihnen zur "guten Regierung" anvertraut waren. Die Herren in Samt und Seide wussten nichts von Ihrer Majestät Untertanen diesseits des Atlantiks, sie kannten nicht einmal ihre Zahl, geschweige denn die genauen Koordinaten ihrer Siedlungsräume.
Das musste sich ändern, und zwar schnell. Die Supermacht der Spätrenaissance konnte es sich nicht leisten, dass eine Meute kurzsichtiger Hofschranzen auf der Kommandobrücke stand und irgendwann das Staatsschiff gegen die Klippen manövrierte. Der Visitator plädierte für eine massive, systematische Aufrüstung des wissenschaftlichen Apparats, der das Führungspersonal der Monarchia universalis in die Lage versetzen sollte, sich "vollständige Kenntnis" zu verschaffen. Das Vorhaben fand die Unterstützung des Königs, den sie in Spanien bis heute den rey prudente, den klugen König, nennen. Bald nahm das Projekt Ausmaße an, die noch heute erstaunen. Um den Informationsaustausch zu verbessern, stellte man dem Indienrat einen obersten Kosmographen und Chronisten zur Seite. Der Rat sollte ferner ein "Buch der Beschreibungen" mit ständig zu aktualisierenden Daten verwahren und das Versenden von Fragebögen an die Amtsträger in Übersee veranlassen mit dem Ziel, aus den Antwortschreiben den gegenwärtigen Zustand der amerikanischen Territorien zu rekonstruieren. Die Liste von 1577 enthält fünfzig thematisch geordnete Abschnitte mit Fragen zu Landschaft, Bodenbeschaffenheit, Klima und Demographie, zu Flüssen, Gewässern, Gezeiten, Strömungen, Höhlen, Vulkanen, Minen, Steinbrüchen, Salinen, Nutzpflanzen, Wildtieren, vorkolonialen Siedlungen, Häfen, Handelswaren, Tributformen, Architektur der Städte usw.
Etwa zweihundert Antwortschreiben haben sich erhalten, die namentlich für Ethnologen, Geographen, Geologen und Biologen von unschätzbarem Wert sind, da sie es erlauben, den Wandel der Lebensbedingungen in den letzten fünfhundert Jahren nachzuvollziehen. Nicht diesen fachwissenschaftlichen Aussagegehalt der Korrespondenz, sondern den Wissenserwerb selbst und dessen Folgen nehmen nun zwei fast gleichzeitig erschienene Studien in den Blick. Als Wissenschaftshistorikerin interessiert sich Maria Portuondo (Baltimore) dabei vornehmlich für den Status der spanischen Staatskosmographie im Kontext der frühneuzeitlichen Wissenschaft (Secret Science. Spanish Cosmography and the New World, Chicago 2009). Sie nennt Leistung und Versagen einer an administrativen Praktiken orientierten Sammelwut beim Namen.
Einerseits beförderte der enge Bezug zur imperialen Politik eine Hinwendung zur Empirie in bisher nicht gekanntem Maße und eine stetige Verflüssigung des Wissenskanons. Für philosophische Spekulationen und das Verfassen elaborierter Traktate in humanistischer Tradition blieb kaum noch Zeit. Unablässig strömten Berichte über neue Beobachtungen in die Amtsstuben. Nunmehr hatte derjenige die besseren Karten, der es verstand, Informationen systematisch zu erfassen und unter funktionalen Gesichtspunkten aufzubereiten. Wissen verlor dadurch die Aura des Statischen und Verstaubten. Andererseits bestand die Gefahr, dass man die gewonnenen Daten nur noch verwaltete und nicht mehr interpretierte. Der eigentlich schöpferische Akt der Erkenntnis ging auf die Weise verloren.
Die Geheimhaltungspolitik der Krone verschärfte diese Tendenz. Da die europäische Konkurrenz auf keinen Fall die wertvollen Seekarten in die Finger bekommen durfte, schottete die Krone ihr kosmographisches Forschungszentrum von der Außenwelt ab - mit dem Erfolg, dass die einen mit der Auswertung ihres reichen Materials nicht vorankamen, während die anderen, denen es verwehrt war, aus den spanischen Fleischtöpfen zu kosten, lernten, die wenigen ihnen zur Verfügung stehenden Daten gründlicher zu analysieren.
Die beachtliche Leistungsfähigkeit der spanischen Institutionen bei der Akkumulation empirischer Tatsachen beruhte zu einem wesentlichen Teil darauf, dass es gelang, die über Jahrhunderte gereifte juristische Kompetenz der Zeugenbefragung für die naturwissenschaftliche Beobachtung nutzbar zu machen. An Juristen gab es in Philipps Imperium keinen Mangel. Wenn sie den Auftrag erhielten, sich nach der Höhe eines Vulkans oder der Tiefe eines Bergsees zu erkundigen, so erfüllten sie ihn mit der gleichen inquisitorischen Präzision, die sie bei der Aufklärung eines Kapitalverbrechens walten ließen. Im Unterschied zu den humanistischen Antiquaren schrieben sie jedenfalls nicht bei Plinius & Co ab. Jedoch hatte das blinde Vertrauen auf die Verlässlichkeit des juristischen Verfahrens unerwünschte Nebenwirkungen. Bei vielen Naturerscheinungen reichte es nicht aus, einfach zu dokumentieren, was die Zeugen gesehen oder gehört hatten. Für den Fachmann waren viele Aussagen wertlos, weil es den Beobachtern an entsprechender Vorkenntnis und wissenschaftlichem Instrumentarium fehlte.
Fällt die wissenschaftshistorische Bilanz der empirischen Revolution im spanischen Zeitalter also zwiespältig aus, so liegt es nahe, erst recht an ihrem machtpolitischen Nutzen zu zweifeln. Wenn sich die Berichte aus Amerika auf den Schreibtischen ungelesen stapelten, dann hatte sich in der Sache nichts geändert, und die Verantwortlichen dekretierten weiterhin weltfremde Entscheidungen. Mit anderen Worten: Philipps Projekt ersoff in den Datenfluten. Doch dieser naheliegende Schluss beruht auf einem Denkfehler, wie Arndt Brendecke in seiner wegweisenden Studie darlegt (Imperium und Empirie. Funktionen des Wissens in der spanischen Kolonialherrschaft, Köln u.a. 2009). Dem selbstgewissen Urteil liegt eine "modernistische Teleologie der Rationalisierung von ,Herrschaft durch Information'" zugrunde, eine Teleologie, die freilich schon den Zeitgenossen nicht ganz fremd war, huldigten sie doch in der Emblematik dem Ideal des alles beobachtenden Herrschers.
Wieder hilft es, sich zu vergegenwärtigen, dass die interrogative Wissensermittlung, die in Übersee zur Anwendung kam, eine Zwillingsschwester der juristischen Wahrheitsfindung war. Juristische Verfahren dienen aber niemals allein dazu, die Wahrheit aufzudecken. Wer sich auf sie einlässt, wird sich fast automatisch mit seiner Rolle im Prozess identifizieren und so die Autorität, die den Ablauf koordiniert, legitimieren. Die amerikanischen Untertanen Philipps begriffen dementsprechend dessen Bemühen, unter Beteiligung aller Wissen zu schaffen, vornehmlich als ein partizipatorisches Versprechen. Erzwingen mussten der König und seine Räte den Informationsfluss zu keinem Zeitpunkt. Im Gegenteil: Als das Völkchen in Übersee das Interesse der Metropole realisiert hatte, beschickte es fortwährend von sich aus die Zentrale mit Berichten über alle möglichen Zustände und Begebenheiten, die ihnen am Herzen lagen.
Was die detailliert ausgearbeiteten Fragebögen anbelangt, so verstanden sie einige dabei als willkommene Anregung, den Wissensstand nach eigenen Maßstäben zu ordnen und zu präsentieren. Ein gewisser Diego Muñoz Camargo beschrieb mehr als dreihundert Manuskriptseiten mit der Geschichte seiner Heimatstadt Tlaxcala und machte sich mit dem Buch unter dem Arm auf die weite Reise zum König, dem er es im fernen Spanien als "Wissensgabe" darbrachte. Das Konvolut war zwar für die Verwaltungspraxis völlig unbrauchbar, aber es dokumentierte Loyalität.
Als Prozessor von Nachrichten zum Zwecke effektiver Interventionen untauglich, war Philipps Unternehmung als Seismograph der königlichen Autorität hoch geeignet. Der auf Dauer gestellte Nachrichtenstrom schuf eine Illusion von Kontrolle und verhinderte dank der Vielzahl an Denunzianten, dass partikulare Machtkonglomerate zu mächtig wurden.
Das alles ist aber nur zu einem Teil ein Bericht aus längst vergangenen Zeiten. Moderne Regierungen operieren gewiss anders als vormoderne. Sie versuchen tatsächlich, Entscheidungen auf der Grundlage präziser und aktueller Daten zu treffen, was manchmal sogar gelingt. Doch gibt es nach wie vor Formen des staatstragenden symbolischen Wissenserwerbs, vielleicht heute mehr denn je. Die Kommunikationsmittel des 21. Jahrhunderts laden geradezu ein zu einem illusionären gegenseitigen Kennenlernen. Dass der mächtige Mann im Weißen Haus gar nicht "twittern" kann, wie sich kürzlich herausstellte, spricht für sich. Offenbar hat er die Lektion seines Ahnherrn gelernt: Auch ein blinder König kann ein kluger König sein.
DANIEL DAMLER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main