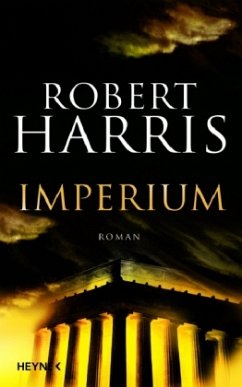"Mehr als nur ein gewitzter Polit-Thriller." -- Süddeutsche Zeitung
"Das liest sich spannend von der ersten bis zur letzten Seite." -- Brigitte
"Liest sich streckenweise wie ein John-Grisham-Gerichtsthriller." -- Weltwoche
MACHT WILL EIN IMPERIUM
„Pompeji“ war ein internationaler Triumph. Robert Harris versteht es wie kein Zweiter, die Antike mit Leben zu füllen und die Gegenwart in einem Roman zu beschreiben, der vor zweitausend Jahren spielt. Im Mittelpunkt von „Imperium“ steht ein gerissener, mit allen Wassern gewaschener Anwalt und geborener Machtpolitiker: Marcus Tullius Cicero.
Ein unbekannter junger Anwalt – hochintelligent, sensibel und enorm ehrgeizig – betritt das Zentrum der Macht. Er hat nur ein Ziel: Er will nach ganz oben. Der Fall eines Kunstsammlers, der vor der Willkür eines skrupellosen und gierigen Gouverneurs fliehen muss, kommt ihm da gerade recht. Der Gouverneur hat einflussreiche und gefährliche Freunde im Senat, und sollte der Anwalt den Fall gewinnen, würde er die gesamte alte Machtclique zerschlagen. An die Niederlage wagt er nicht zu denken, sie könnte ihn das Leben kosten. Eine einzige Rede kann über sein Schicksal und die Zukunft einer Weltmacht entscheiden, doch seine gefährlichste Waffe ist das Wort.
Die Weltmacht am Scheideweg ist Rom. Der Name des jungen Anwalts ist Marcus Tullius Cicero, Außenseiter, Philosoph, brillanter Redner und der erste Politiker modernen Stils.
Ein topaktueller Roman im historischen Gewand.
"Das liest sich spannend von der ersten bis zur letzten Seite." -- Brigitte
"Liest sich streckenweise wie ein John-Grisham-Gerichtsthriller." -- Weltwoche
MACHT WILL EIN IMPERIUM
„Pompeji“ war ein internationaler Triumph. Robert Harris versteht es wie kein Zweiter, die Antike mit Leben zu füllen und die Gegenwart in einem Roman zu beschreiben, der vor zweitausend Jahren spielt. Im Mittelpunkt von „Imperium“ steht ein gerissener, mit allen Wassern gewaschener Anwalt und geborener Machtpolitiker: Marcus Tullius Cicero.
Ein unbekannter junger Anwalt – hochintelligent, sensibel und enorm ehrgeizig – betritt das Zentrum der Macht. Er hat nur ein Ziel: Er will nach ganz oben. Der Fall eines Kunstsammlers, der vor der Willkür eines skrupellosen und gierigen Gouverneurs fliehen muss, kommt ihm da gerade recht. Der Gouverneur hat einflussreiche und gefährliche Freunde im Senat, und sollte der Anwalt den Fall gewinnen, würde er die gesamte alte Machtclique zerschlagen. An die Niederlage wagt er nicht zu denken, sie könnte ihn das Leben kosten. Eine einzige Rede kann über sein Schicksal und die Zukunft einer Weltmacht entscheiden, doch seine gefährlichste Waffe ist das Wort.
Die Weltmacht am Scheideweg ist Rom. Der Name des jungen Anwalts ist Marcus Tullius Cicero, Außenseiter, Philosoph, brillanter Redner und der erste Politiker modernen Stils.
Ein topaktueller Roman im historischen Gewand.

Robert Harris' Roman "Imperium" erzählt von antiker Politik und hat die Gegenwart im Blick
Da steht er schon und guckt vorwurfsvoll, ein steinerner Gast in der Ecke des Arbeitszimmers. Marcus Tullius Cicero, eine Büste mitten in England. Der Schriftsteller hat am Dorfbahnhof in der Grafschaft Berkshire gewartet, wir sind auf dem alten Treidelpfad an einem Kanal entlanggegangen, über eine alte Steinbrücke, sehr idyllisch, hinein in das große ehemalige Pfarrhaus, die Putzfrau saugt, im Garten sind die Spuren der Kinder nicht zu übersehen, und Robert Harris' Frau Jill, die Schwester von Nick Hornby, will gerade mit dem Hund raus. "Wer will schon in London wohnen?" sagt Harris, der sich vor 13 Jahren, nach dem Erfolg von "Vaterland", dieses Haus gekauft und London den Rücken gekehrt hat.
Drei Weltbestseller später gefällt es dem 49jährigen hier noch immer. Harris hat sich in "Vaterland" vorgestellt, wie Hitler den Krieg gewann, er hat einen Thriller über eine britische Abhörstelle im Zweiten Weltkrieg geschrieben ("Enigma") und einen Skandal um Stalin ausgeheckt ("Aurora"). Und dann hat er Pompeji noch einmal untergehen lassen. "Ich hätte mich kaputtgelacht, wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde einen Roman über die Antike schreiben", sagt er. Nun sind's schon zwei. Aber warum bloß Cicero? Man zuckt ja noch immer zusammen. Die Reden gegen Verres - die reinste Folter. Und Catilina - wie lange will dieser Cicero denn noch unsere Geduld mißbrauchen? Der Schrecken des Lateinunterrichts als Romanheld in "Imperium"?
Ihn habe geärgert, wie der berühmte Theodor Mommsen "Caesar zum Supermann gemacht und Cicero mit den Worten abgetan hat, er sei ein Journalist der übelsten Sorte. Da wußte ich: Das ist mein Held", sagt Robert Harris und lacht. Aber im Grunde ist Amerika schuld an der verlängerten Zeitreise. Schon "Pompeji" war die Folge eines Scheiterns. Harris hatte sich mit einem Buch über die Vereinigten Staaten gequält, es funktionierte einfach nicht, nicht mal als politische Allegorie. Als er dann, noch vor 9/11, einen Artikel über neue Ausgrabungen in Pompeji las, paßte plötzlich alles zusammen. Ein Weltreich, von einer Naturkatastrophe erschüttert, "da läßt sich einiges sichtbar machen im Paralleluniversum der Alten Welt". Und die Parallelen gehen ihm nicht aus. Für die "Daily Mail" hat er kürzlich etwas geschrieben über die Attacke der Seeräuber auf die konsularische Flotte im Jahr 67 vor Christus. "Das war Roms 9/11", sagt der Kolumnist, der gerne eine Analogie auf die Spitze treibt.
"Imperium" steht derzeit in den Londoner Buchläden direkt neben den Autobiographien von Wayne Rooney und Frank Lampard, was Harris amüsiert, der die Fußballmanie seines Schwagers nicht teilt - "deshalb hat mich meine Frau geheiratet". "Imperium", das ist nicht das Römische Reich, sondern die politische Macht, die auf einen einzelnen übertragen wird. Und es ist die Politik, die das Denken von Robert Harris bewegt, der erst bei der BBC, dann beim "Observer" als Journalist arbeitete. Ciceros Leben, "das ist Politik in Aktion". Und bevor man noch fragen kann, warum sich "Imperium" auf die Jahre 79 bis 64 vor Christus beschränkt, obwohl Cicero erst 21 Jahre später ermordet wurde, spricht Harris schon von einer Trilogie: 1200 Seiten, Ciceros Leben als historischer Roman und als Panoramabild von Roms großer Krise.
Und in dieser römischen Republik des ersten Jahrhunderts vor Christus, da liegt der Stoff wenn nicht für einen politischen Thriller, dann doch für ein großes Drama: Bürgerkrieg, Intrigen, Mord und Macht. Es war die Zeit, als ein Weltreich mit einem politischen System, das auf einen Stadtstaat zugeschnitten war, an seine Grenzen stieß und in eine "Krise ohne Alternative" taumelte, wie das der Althistoriker Christian Meier genannt hat. Und es gab ein enormes Aufgebot an großen Gestalten: Pompeius, Caesar, Crassus, Cato, Catilina, Clodius - und eben Cicero. Der größte Redner, der gerissenste Anwalt, der ehrgeizige Aufsteiger ohne aristokratischen Hintergrund.
Harris bewundert Ciceros bösen Witz und Scharfsinn, seinen Mut und seinen Pragmatismus. "Cicero war immer der Außenseiter, er war immer latent bedroht, er hat sein eigenes Image entworfen und daran geglaubt, und all das macht ihn zu einer guten Romanfigur." Aber wer soll das lesen, trotz des erstaunlichen Erfolgs, den die hundert Millionen Dollar teure amerikanische Fernsehserie "Rom" gehabt hat? Politik von vor 2000 Jahren, kein Sex, kein Crime und keine Apokalypse?
Harris lächelt sorglos. Er hat ja immer die Gegenwart vor Augen. Die große Frage sei doch: "Wie kann man die einzige Supermacht sein und eine funktionierende Demokratie behalten?" Natürlich denkt er an Amerika, an das Zusammenspiel von Regierung, Geheimdiensten und militärisch-industriellem Komplex. Die römische Form der Republik sei doch sehr "sophisticated" gewesen, sagt er, "und man sieht, wie leicht man diese Eigenschaften verlieren kann. Aus der Ferne betrachtet, gibt es da interessante Muster." Und jenseits dessen gibt es die Faszination, auf der Basis von Ruinen und Quellen eine ganze Welt zu rekonstruieren. Es sei doch elektrisierend, sich das vorzustellen, die Tage der Stimmabgabe auf dem Forum, die Reden, die aufgeheizte Menge. Was man davon weiß, ist nur ein verblaßtes, fragmentiertes Fresko, das die historische Fiktion geradezu einlädt, es sich auszumalen.
Und der Alltag im republikanischen Rom? Harris winkt ab. "Wir lesen doch Catulls Liebesgedichte und spüren, daß sich soviel nicht verändert hat. Und wenn man ein Gespür für die Topographie des antiken Roms bekommen will, muß man sich die Gassen von Marrakesch ansehen, den Lärm, den Dreck, die Enge, den Luxus und die Stille hinter unauffälligen Türen." Es ist schon erstaunlich, wie selbstverständlich und geschmacklich sicher Harris diese Fragen behandelt. Mit der Hollywood-Antike aus falschem Marmor, gedrechselten Säulen und spartanisch möblierten Räumen hat das nichts zu tun. Und es gelingt ihm auch, den komplizierten politischen Apparat für Leser anschaulich werden zu lassen, die noch nie von Comitien oder Ädilen gehört haben. Man erfährt fast beiläufig, wie die Ämterlaufbahn aussah und wie die Abstimmungen funktionierten, welche Rolle Senat und Volksversammlung spielten, wie man sich einen Gerichtsprozeß vorstellen muß, wie Wählerstimmen gekauft, mit welchen Tricks Gesetze auf den Weg gebracht wurden. Es ist ein großes Politik-Theater, und deshalb ist es plausibel, daß Cicero nicht nur Rhetorikunterricht nahm, sondern auch im Theater die Schauspieler studierte. Harris hat das jedoch nicht auf diese dämliche Weise modernisiert, welche der Antike einfach Begriffe wie Revolution, Partei oder soziale Frage überstülpt. Da verzeiht man ihm auch, wenn er Cicero mal sagen läßt: "Schlafen können wir, wenn wir tot sind."
Die ideale Perspektive auf das alte Rom hat er allerdings erst spät gefunden. Da gab es schon mehr als sechshundert Manuskriptseiten und noch immer keine Erzählerstimme. Der onkelhafte Alleswisser-Ton kam nicht in Frage, und Cicero hat ja in seinen zahlreichen Schriften schon genug von sich gesprochen. Ein Nebendarsteller war die Rettung, Tiro, Ciceros rechte Hand, der Haussklave, der die erste Kurzschrift entwickelte und Ciceros Reden mitstenographierte. Dieser Tiro hat sogar eine nicht erhaltene Cicero-Biographie geschrieben, und insofern ist Harris' Lösung auch historisch zwingend. Tiro ist selber keine zentrale Figur, aber immer im Zentrum dabei, er kann sich Ironie leisten und nüchtern von Demütigungen berichten, wenn der Stratege Cicero sich ausgekontert sieht oder seine Prinzipien einer neuen Taktik unterordnet. Und ganz lakonisch heißt es gegen Ende: "Von jetzt an trug er permanent das zur Schau, was ich später sein ,Konsulgesicht' nannte." Obwohl Tiro manchmal zur Weitschweifigkeit neigt, ist "Imperium" ein Buch, das man verschlingt. Sogar der Prozeß gegen den korrupten Statthalter Verres, den Cicero mit sicherem Instinkt als Karrieresprungbrett nutzt, ist auf einmal spannend; man sieht, wie Cicero widerwillig in den Machtradius des Pompeius gerät, wie er sich in aller Schläue doch immer wieder in seinem Machtkalkül verrechnet, und man freut sich schon darauf, wie er sich im nächsten Buch als Konsul den Verschwörer Catilina vornehmen wird, in seiner großen Selbstinszenierung als letzter Wahrer republikanischer Werte.
Ja, so spannend kann Politik sein. Das ist nicht das Grau in Grau gesichtsloser Kommissionen, die stundenlang Kaffee trinken und hinterher von harten Kämpfen sprechen. "Es ist ein großes Theater", sagt Harris noch einmal, "voller Risiken, voller Adrenalin." Und während wir dann nach einem sehr britischen Mittagessen vorm Pub stehen und auf den Fahrer warten, der Harris zum Flughafen bringen soll, sagt er noch schnell, er habe nie Politiker werden wollen, "weil ich keine Lust habe, Leuten zu sagen, was sie tun sollen". Dann muß er los, auf große Lesereise, den Leuten sagen, was sie lesen sollen. Internationaler Bestsellerautor - wäre das nicht auch ein Job für Cicero gewesen? Robert Harris lacht und verschwindet im Wagen.
PETER KÖRTE
Robert Harris: "Imperium". Roman. Aus dem Englischen von Wolfgang Müller. Heyne-Verlag. 500 Seiten, 19,95 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Beeindruckt ist Ijoma Mangold von Robert Harris' Roman "Imperium", der die politische Karriere des großen Redners und Staatsmanns Cicero aus der Perspektive seines Sklaven und Privatsekretärs Tiro schildert. Er lobt das Buch als gut und spannend geschrieben, als "klug" und "gewitzt" und bescheinigt Harris, das "Räderwerk der Macht" mit "feinem Gespür und kaltem Blick" zu durchleuchten. Dabei hält er dem Autor zu Gute, Politik nicht als einziges Hauen und Stechen zu zeichnen, sondern der Komplexität des Geschehens, in dem Eitelkeit und rechtliche Institutionen, Machtstreben und Sachnotwendigkeiten, Ideen und Geld, Psychologie und Theater eine Rolle spielten, Rechnung zu tragen. Die ambivalente Figur Ciceros scheint Mangold für dieses Thema besonders geeignet, verbinden sich in dem Aufsteiger doch Eigenschaften wie Machtstreben, politische Klugheit und überragendes Rednertalent. Harris gelingt seines Erachtens nicht nur, geschickt viel "O-Ton Cicero" einzubauen, sondern auch viele Facetten der Macht wie die Instrumentalisierung von Moral und politische Theatralik einzufangen, so dass ihm der Roman bisweilen wie ein "Handbuch der Machttechniken" anmutet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH