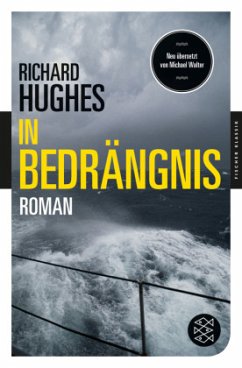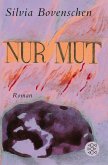Richard Hughes' Roman ist eine Hymne an die Ausdauer und eine Parabel auf das Leben. Eigentlich sollte der Frachtdampfer nur durch die Karibik und den Panamakanal nach China. Doch dann stellt sich das Wetter dagegen. Das Schiff gerät in einen Hurrikan, der es vier Tage lang nicht aus den Fängen lässt und seiner Crew alles abverlangt. Am Ende ist das Schiff ein Wrack, aber die Männer haben überlebt: »Was als Siegeszug der Moderne beginnt, endet im Desaster.« (Oskar Piegsa, Spiegel online)
»... so fantastisch spannend geschrieben, dass man gar nicht mehr aufhören kann ... Tolles Buch!« Elke Heidenreich, Literaturclub SF 1
»... so fantastisch spannend geschrieben, dass man gar nicht mehr aufhören kann ... Tolles Buch!« Elke Heidenreich, Literaturclub SF 1
"... so fantastisch spannend geschrieben, dass man gar nicht mehr aufhören kann. Tolles Buch!" Elke Heidenreich, Literaturclub SF 1

Hoffnung in der Krise, und das nicht nur für den Buchhandel: Die Literatur steuert auf einen starken Herbst zu. Ein halbes Dutzend großartiger Romane kommt schon in den nächsten Wochen.
Ein Sturm zieht auf. Ein kleiner nur im Kontext der ökonomischen Großwetterlage, aber ein gefährlicher für den deutschen Buchhandel. Das erste Halbjahr brachte ihm ein Umsatzminus von 2,6 Prozent, und im Sortimentsbuchhandel, also in den klassischen Buchgeschäften, war angesichts der Verlagerung vieler Käufe in den Online-Handel der Rückgang sogar mehr als doppelt so groß: 5,4 Prozent. Vor allem die großen Buchhausketten, die im vergangenen Jahrzehnt die kleinen Fachgeschäfte verdrängt hatten, schließen jetzt selbst Filialen. Die Ratlosigkeit in der Branche ist groß, man hofft aufs zweite Halbjahr. Eines immerhin kann man darüber schon sagen: Es bietet einige sehr gute Bücher.
Ein Sturm zieht auf, doch niemand hat ihn kommen sehen. Die modernen Prognoseinstrumente haben versagt, im Chaos bleibt nur noch ein improvisiertes Rettungsmanöver nach dem anderen. Das ist nicht das aktuelle EU-Krisenszenario, sondern die sehr geraffte Handlung eines erstaunlichen englischen Romans, den Richard Hughes 1938 veröffentlichte: "In Hazard". Noch im selben Jahr wurde er als "Von Dienstag bis Dienstag" erstmals ins Deutsche übertragen, später hieß er hierzulande "Hurrikan im Karibischen Meer". In der großartigen Übersetzung von Michael Walter heißt er nun originalgetreu "In Bedrängnis". Und wenn Sie ein einziges Buch lesen wollen, das genau in die Gegenwart passt, dann sollte es dieser ein Dreivierteljahrhundert alte Seefahrtsroman sein.
Ein Sturm zieht auf, und vier Tage lang kämpft darin die "Archimedes". Der Dampfer ist Teil der Flotte einer Reederei namens "Sage" (was im Englischen den Weisen bezeichnet), die alle ihre Schiffe nach Philosophen benannt hat. Archimedes hatte behauptet, dass er die Welt aus den Angeln heben könnte, wenn er nur einen festen Punkt für einen langen Hebel hätte. Der einzige feste Punkt ist nun die "Archimedes" selbst, doch im Toben der Elemente ist sie haltlos, alle Sicherheiten zerbrechen. "Captain Edwardes begriff jetzt, dass nicht einmal in siebzehn Stunden mit einem Entkommen zu rechnen war. Überhaupt konnte man auf kein Entkommen spekulieren, solange der gewaltige Sog des Sturms andauerte. Man konnte auf gar nichts mehr bauen." Dieser Roman ist das ultimative Krisenbuch.
Beschwingt in der Katastrophe
Auch weil darin eine Psychologie des Umgangs mit der Krise entwickelt wird, die mehr über das, was wir derzeit an ungebrochenem Optimismus beobachten, erzählt als die umfangreichsten aktuellen Fallstudien. Mitten im Sturm kommt dem Kapitän die Erkenntnis, dass das bisherige Überleben auch den bereits eingetretenen Katastrophen zu verdanken ist, weil sie zu den Bedingungen beigetragen haben, in denen man überlebt hat. "Ja, Captain Edwardes war bester Laune! Hätte er schon im Voraus gewusst, was passieren würde, wäre er dann die ganze Zeit so fröhlich und zuversichtlich gewesen? Vielleicht nicht. Vielleicht hätte niemand dies Vorherwissen verkraftet. Da er jedoch immer nur von einer bekannten Situation zum nächsten unbekannten Augenblick vorausschaute, hatte ihn seine Unbeschwertheit beschwingt."
Das Buch ist ein Sprach- und Beschreibungskunstwerk, es ist rasend spannend, und es erzählt weitaus mehr, als es zunächst den Anschein hat. Schon der Handlungszeitpunkt im November 1929, kurz nach dem Börsencrash an der Wall Street, ist ein Signal, und wenn der Erste Offizier sich darüber Rechenschaft ablegt, warum er Seemann geworden ist, dann klingt das so: "Der Grund lautete, dass er die Tugend liebte und kein Homo oeconomicus war." Richard Hughes hat am Ende der Weltwirtschaftskrise und im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs eine Parabel auf das Krisenbewusstsein geschrieben, die seitdem nicht überholt ist.
Ansonsten ist die Krise in den herausragenden Büchern der kommenden Saison bestenfalls Folie. Wie in Stephan Thomes "Fliehkräfte", dem Nachfolgeroman des 2009 gefeierten Debüts "Grenzgang". Hatte Thome bei dessen Thema noch von der eigenen Herkunft profitiert, wählt er nun als Protagonisten einen Mann, der zwanzig Jahre älter ist als sein 1972 geborener Autor und als Philosophieprofessor am Scheideweg steht: Seine portugiesische Frau, die ehemalige Muse eines Theaterregisseurs, in dem leicht Frank Castorf zu erkennen ist, hat als dessen Referentin eine Stelle in Berlin angenommen, um endlich wieder auf eigenen Füßen zu stehen, die Tochter studiert in Spanien. Das gemeinsame Leben, wie Hartmut Hainmann es kannte, ist dahin, und er sucht Rettung in einer langen Fahrt von Bonn bis Porto, um etwas davon wiederzufinden. Doch er wird alles verlieren.
Europa mit seinen verschiedenen Nationen, Sprachen und Kulturen wird in "Fliehkräfte" zum Antidot der schleichenden Identitätsvergiftung. Aber die Reise zu sich selbst kann nicht im Rhythmus der wechselnden Begleiter stattfinden, die Hainmann auf seiner Fahrt begegnen. Immer jedoch scheint in ihnen, ihrer Fremd- oder Vertrautheit (nicht selten trifft beides zusammen), die Vision einer Aussöhnung auf. Kein reinigender Sturm zieht auf, aber dass Thome diesen großen Roman auch in einer Erfahrung des Meeres kulminieren lässt, einer ganz sanften, aber umso ambivalenteren, macht ihn zum zweiten Teil einer Trias der besten kommenden Bücher, die ihre Protagonisten den Elementen ausliefert.
Den dritten Teil steuert Vladimir Sorokin mit "Der Schneesturm" bei. Der lapidare Titel verweist auf Tschechow, und gemeinsam mit Gogol ist das auch der Bezugspunkt, von dem aus der 1955 geborene russische Autor ein Vexierspiel mit der literarischen Tradition seiner Heimat entfaltet, dass nicht nur dem Landarzt Platon Iljitsch Garin, der hier mit der Kutsche in den titelgebenden Sturm geschickt wird, Hören und Sehen vergehen, sondern auch den Lesern.
Sorokin, der Meister postmodernen Schreibens in Russland, erzählt hier in ganz klassischem Ton. Aber er mischt russische Vergangenheitstopoi wie die Kutschfahrt, einen devoten Fuhrmann oder die archaischen Zustände in den Dörfern mit Elementen der phantastischen Literatur, die eines Lovecraft würdig sind. Zudem wird bald klar, dass hier von einem künftigen postapokalyptischen Russland erzählt wird: als Dystopie, in der Mutationen und Infektionen das Verständnis von Menschlichkeit ebenso in Frage stellen, wie es die gnadenlose Isolation in einem Land, in dem jeder soziale Zusammenhalt zerfallen scheint, mit der Moral getan hat. 2010 auf Russisch erschienen, hat dieser Roman nach Putins Wiederwahl zum Präsidenten nur noch an Aktualität gewonnen. Die schwarze Pest, die die Erkrankten, die zu heilen Garin aufbricht, in zombiehafte Riesen verwandelt, ist Metapher der Macht.
Eine Krankheit ist auch der Ausgangspunkt von "Indigo", dem neuen Roman von Clemens J. Setz, dem Nachfolger von Daniel Kehlmann als Wunderkind der österreichischen Literatur. Mit noch nicht dreißig Jahren hat Setz sich längst den Ruf eines formal wie inhaltlich gleichermaßen wagemutigen Prosaisten erworben, der nun von "Indigo" nicht nur bestätigt, sondern ausgebaut wird. Was Thomes "Fliehkräfte" psychologisch herausragend macht, wird bei Setz noch durch Lust am erzählerischen Experiment ergänzt. Der Rückgriff auf in der Romantik entwickelte Techniken wie Montage, Dokumentationsfiktionen oder Verschleierung (hier im Buch auch typographisch unterstützt) und die Integrierung einzelner Fotos in den Text nach Sebaldschem Vorbild setzt eine Erzählung in Gang, die in ihrem überbordenden Reichtum an Anspielungen aus Literatur, Film, Musik und Comic einem gigantischen Bilderrätsel gleicht. Seine Auflösung führt auf den Friedhof.
Zentraler Protagonist, mutmaßlicher Mörder und einziger Ich-Erzähler unter vielen Stimmen ist ein gewisser Clemens Setz, der in einem Internat, in dem vom rätselhaften Indigo-Syndrom befallene Kinder untergebracht sind, sein Schulpraktikum als Mathematiklehrer absolviert hat. "Dingos" nennt man spöttisch die Erkrankten, die weniger selbst leiden, vielmehr jedem Gesunden Kopfschmerzen bereiten. Solch ein Dingo ist auch das Buch: Man kommt nicht heil davon weg. Es herrscht Suchtgefahr. Alsbald sind beim Lehrer alle Sicherheiten verloren, beim Leser auch. Ein ständiger Wechsel von Vergangenheit (2006/07) und Zukunft (2021) ist da noch das Wenigste.
Sprünge in die Zukunft hat man auch in Jenny Erpenbecks "Aller Tage Abend" zu überstehen. Es sind jeweils Sprünge ins Imaginäre, denn jeder der fünf Teile des Romans endet mit dem Tod. Gleich zu Anfang stirbt ein Säugling und mit dem kleinen Mädchen ein ganzes Leben voller Möglichkeiten. Doch in einem Intermezzo zwischen erstem und zweitem Teil wird dieser Tod korrigiert, und so kann die Geschichte doch noch in Gang kommen und von 1901 in die Jahre 1919, 1938, 1962 und 1992 springen. Immer wieder stirbt das Mädchen, die junge Frau, die Mutter, die Großmutter aufs Neue, um in weiteren Intermezzi wieder ins Leben zurückgeholt zu werden.
Stellt alles dem Zufall anheim
Das ist fabelhaft konstruiert und einmal mehr in der vertraut entschlackten Stimme der heute fünfundvierzigjährigen Jenny Erpenbeck erzählt. Ihr vielfach ausgezeichneter Roman "Heimsuchung" verwendete 2008 ein ähnlich zeitübergreifendes Motiv, doch wo dort ein Grundstück das verbindende Element bildete, ist es hier nicht einmal die Frau selbst, deren vielfach wiedergeschenktes Leben wir begleiten, sondern der Zufall in Gestalt jener winzigen Aspekte, die über Tod und Leben entscheiden. "Schön wäre es, wenn der Zufall regieren würde, und nicht ein Gott", heißt es einmal im Buch. Dann wäre niemals aller Tage Abend.
Der schönste und zugleich doppelbödigste deutschsprachige Roman des Herbstes jedoch bleibt streng einem unerbittlichen Geschick verhaftet: der Politik. Es ist ein Familienroman: Ein Jahrzehnt nach seiner Flucht aus Deutschland kehrt der ehemalige Berliner Patentrichter Richard Kornitzer 1948 in sein Heimatland zurück. Er ist Jude, und seine protestantische Frau Claire blieb, als er 1939 nach Kuba emigrieren konnte, in Deutschland zurück; die beiden Kinder waren schon vorher nach England geschickt worden. Was hat Claire in der Zeit der Trennung erlebt? Was Richard?
Für die 1947 geborene Ursula Krechel ist "Landgericht" erst der zweite Roman nach ihrem späten Debüt "Shanghai fern von wo" (2008). Wieder verbindet sie eine akribische zeitgeschichtliche Faktenrecherche mit fiktiver Erzählung: innerem Monolog, Reflexion, Hadern. Doch während im "Shanghai"-Roman die Rückkehr deutscher Exilanten in die Bundesrepublik und ihr juristisches Ringen um ausgleichende Gerechtigkeit nur ein Element des Geschehens waren, wird "Landgericht" jetzt zum großen Prozess Richard Kornitzers gegen ein Land, das so schnell wie möglich wieder zur Normalität übergehen will. Nur hat es dabei mit Kornitzer zu tun - einem Mann, der um sein Recht (und bisweilen auch persönliches Unrecht) nicht nur weiß, sondern es auch einzutreiben versteht. Ein Sturm zieht auf - privat und gesellschaftlich.
Drei Bücher, in denen es ums Weiterleben geht (Hughes, Thome, Krechel), drei Bücher, in denen es ans Sterben geht (Sorokin, Setz, Erpenbeck). Sechs Bücher, in denen es um alles geht. Mit ihnen kommen wir durch den Sturm, auch der Buchhandel.
ANDREAS PLATTHAUS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Nicht nur der Autor ist in der nautischen Sprache bewandert, auch der Übersetzer, stellt Jürgen Brocan verblüfft fest. Die Neuübersetzung dieses klassischen Seefahrerromans von Richard Hughes besticht laut Borcan durch ihre nüchterne Präzision. Die genaue Schilderung der Abläufe, aber auch die raffinierte Darstellung des Innenlebens der den Elementen aufs Äußerste ausgesetzten Personen im Buch lassen den Rezensenten den alten Topos vom Kampf Mensch gegen Natur in selten gelesener spannender und wuchtiger Version erleben, spannender als etwa Conrads "Taifun", wie Brocan erklärt. Dass dem Text ein wahres Ereignis, die mehrtägige Seenot des Dampfers "Phemius" im Jahr 1932 zugrundeliegt, steigert den "Schockeffekt des Realen" in diesem Buch für Brocan noch weiter.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH