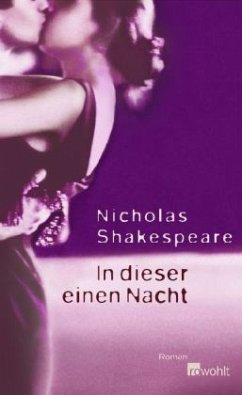Der junge Brite Peter Hithersay besucht mit einer Theatergruppe mitten im Kalten Krieg Leipzig und verliebt sich Hals über Kopf in eine junge ostdeutschen Frau, die sich eben erst dessen bewusst wird, dass sie in einer Diktatur lebt. Doch als sie sein leichtfertiges Angebot, sie im Requisitenkoffer außer Landes zu schmuggeln, annimmt, kneift er - der edle Artus als Duckmäuser. Die nächsten neunzehn Jahre redet er sich täglich ein, er sei nicht in sie verliebt gewesen. Aber die Wunde heilt nie. Besessen von Deutschland und seiner Schuld, studiert Peter in Hamburg, wird Arzt, landet schließlich in Berlin. Er hat großen, ja bedenklichen Erfolg bei Frauen, doch stets bleibt ein schaler Nachgeschmack. Dann fällt die Mauer, aber nach Leipzig fährt er nie. Erst ein Zufall führt ihn schließlich zurück..."In dieser einen Nacht" ist eine hinreißende Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des geteilten Deutschland - ein grandioses Gesellschaftsporträt, das die politische Absurdität des Lebens
in der Diktatur ebenso minuziös erfasst wie den spezifischen Braunkohlegeruch, das Grau der Plattenbauten, die Überwachungskamera im Gartenzwerg. Shakespeares zugleich romantischer und klarsichtiger Blick, der Blick eines geborenen Fabulierers, macht dieses Buch zu etwas ganz Besonderem.
in der Diktatur ebenso minuziös erfasst wie den spezifischen Braunkohlegeruch, das Grau der Plattenbauten, die Überwachungskamera im Gartenzwerg. Shakespeares zugleich romantischer und klarsichtiger Blick, der Blick eines geborenen Fabulierers, macht dieses Buch zu etwas ganz Besonderem.

DDR, schwer verdaulich: Nicholas Shakespeares Schmonzette
Kann es was Herzzerreißenderes geben als einen Liebesroman, bei dem die Liebenden wie zufällig zusammenkommen und nur eine Nacht durchleben dürfen, ehe düstere Machenschaften und Verrat sie trennen, so daß sie sich erst wieder nach Jahrzehnten der Vergeblichkeit neu finden? Kann es etwas Spannenderes geben als einen Politthriller, in dem erst das altvertraute Spiel des Kalten Krieges, dann das jüngst entdeckte der Stasi das Geschehen dominiert und so lange immer weitere verwirrende Spuren legt und Fäden spinnt, bis der Showdown schließlich dreifach vor einem geheimen Aktenschrank, bei einer aufgedunsenen Wasserleiche und an einem kalten Grabstein endet? Kann es schließlich etwas Leidenschaftlicheres geben als einen Arztroman, bei dem der Chefarzt bis zur Grenze menschenmöglicher Verausgabung um die Genesung der Patienten ringt, während er sein Liebesleben in die Hand der stillen Oberschwester legt, dazu der rätselhaften Alten, die schon im Sterbezimmer liegt, seine Lebensbeichte ablegt und zwischendurch kurz in der Wäschekammer der drallen Schwesternschülerin, die ihm stets mit dem Ruf-mich-an-Blick folgt, das Hemd aufknöpft?
So oder so ähnlich mag der englische Autor Nicholas Shakespeare bei der Planung seines jüngsten Romans überlegt haben, wie er den großen Erfolg seines vorigen, "Der Obrist und die Tänzerin" (1998), der mit John Malkovich verfilmt wurde, noch einmal steigern könnte. Vielleicht kamen ihm dabei so viele gute Einfälle, daß ihm die Auswahl zwischen den bewährten Mustern schwerfiel. Vielleicht aber war er auch selbstkritisch genug, keinem seiner Einfälle so richtig zuzutrauen, Spannung, Emotion und Handlung über mehr als 500 Seiten zu entfalten. Statt jedoch weiter nachzudenken, muß er dann auf die Idee gekommen sein, alles miteinander zu verbinden und einfach einen Liebespolitarztroman zu schreiben, der sogar, um ganz sicher zu gehen, neben viel ostdeutscher Exotik auch noch ein bißchen britischen Heimatroman bietet. Nur eines hat er bei aller Erfolgsvorsorge nicht bedacht: daß wir uns als Leser gern verführen, aber nicht verschaukeln lassen. Ein junger Engländer, der in den siebziger Jahren gerade seine Pubertät in einem repressiven Internat durchleidet, erfährt mit einemmal von seiner Mutter, daß er der Sohn eines ostdeutschen Strafgefangenen ist, mit dem sie im Jahr vor dem Mauerbau eine kurze Liebesnacht auf seiner Flucht genoß, bevor sich seine Spur im Zonenrandgebiet verlor. Die langwierige Vatersuche, die der völlig konsternierte Sohn sogleich nach der Enthüllung aufnimmt, führt ihn zunächst nach Hamburg, wo er Medizin studiert, Anfang der achtziger Jahre endlich nach Leipzig, wo die Mutter damals zu Besuch war und wo er nun anhand von Toast Hawaii, Braunkohlestaub und Polizeigewalt erfährt, welches Leben ihm erspart geblieben ist. Zwar kommt er dabei nicht dem Vater, dafür aber einer jungen Frau näher, deren Herz er - darin ganz deutscher Kulturweltbürger - mit der Erklärung "Ich liebe Bach" gewinnt.
Sie erinnert ihn an eine Giraffe, trägt den wundersamen Namen Snjólaug und führt ihn in eine Gruppe kirchlich engagierter Dissidenten ein, bevor sie ihn wiederum für eine einzige kurze Nacht in Omas Gartenlaube mitnimmt. Trotz der sogleich entflammten Liebe, die den vaterlosen Mediziner fortan heillos umtreibt, scheitert am nächsten Tag ihr Plan der Republikflucht an seinem feigen Kleinmut. Was genau in jenem schicksalhaften Augenblick geschah, da sie sich kurz vor seiner Rückkehr in den Westen ein letztes Mal gegenüberstanden, wer hier im Hintergrund Regie führte und was genau gespielt wurde, wird sich erst lange Jahre später herausstellen, wenn die Mauer gefallen, die Archive geöffnet und die geheimen Akten überbracht sind. Die Laubenwonne jedenfalls, soviel ist von Beginn an klar, hat die Stasi sorgsam abgehört, protokolliert und durch Geruchsproben bewahrt. Das Mikro war im Gartenzwerg versteckt.
Keine Frage, das alles wäre Stoff für große und bewegende Geschichten. Um die jedoch wirksam zu erzählen, braucht es nicht nur sprachliche Gestaltungskraft, sondern vor allem einen klaren Blick für erzählerische Ökonomie. Beides zählt nicht zu den Stärken dieses Autors. Anläßlich einer Sendung im Autoradio erfahren wir: "Das Lied hatte rote Augen und lief klammheimlich in seiner Vorstellung hin und her, während er in dem Versuch, sich zu beherrschen, zwischen Tränen und Wut schwankte. Es war eine als Versprechen getarnte Ratte, die er am liebsten zwischen die Zähne genommen und geschüttelt hätte, bis sie verstummte." Gewiß tönt oftmals furchtbare Musik aus dem Radio, doch solche Stilblüten, wie sie sich allenthalben finden und in Hans Herzogs Übersetzung gnadenlos wiederkehren, stehen einem schlechten Schlager in nichts nach.
Nicht nur bei den Metaphern, auch bei den Handlungselementen geht Shakespeare gern aufs Ganze, plündert den Fundus der Versatzstücke des Schicksalhaften und bringt davon in den Abenteuern seines leidgeprüften Helden so viel unter, daß es unschwer für drei reichen sollte. Doch gerade in der Genrefiktion gelten strikte Regeln der Enthaltsamkeit. Diese lassen sich umspielen oder auch gezielt durchbrechen, aber nicht in ihrer Wirksamkeit durch schiere Überbietung steigern.
Wer eine gekonnte, spannende, politisch brisante und souverän durchkomponierte Spitzel- und Lebensgeschichte vor deutsch-deutscher Kulisse lesen will, der greife zu "Absolute Freunde" (2004) von Altmeister John Le Carré, dem Shakespeare offensichtlich seine stärkeren Einfälle verdankt. Im Vergleich dazu wirkt "In dieser einen Nacht" wie eine als Versprechen getarnte tote Ratte, die wir am liebsten zwischen die Zähne nehmen und so lange schütteln würden, bis sie verstummt.
TOBIAS DÖRING
Nicholas Shakespeare: "In dieser einen Nacht". Roman. Aus dem Englischen von Hans M. Herzog. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2006. 536 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Als "passionierten Fabulierer" schätzt Gerrit Bartels den britischen Schriftsteller Nicholas Shakespeare, und ist in seinen Erwartungen an diesen Wenderoman keineswegs enttäuscht worden. Er erzählt die recht vertrackte Geschichte zweier englisch-deutschen Liebespaare, deren Schicksale natürlich in der Schicksalsstadt Leipzig kulminieren. So erfährt der junge Peter Hithersay, dass er nicht, wie immer geglaubt, der Sohn eines englischen Glückwunschkartenmalers ist, sondern dass er in einer Nacht gezeugt wurde, als seine Mutter - zu Gast bei einem Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb in Leipzig - einem politischen Häftling zur Flucht verhalf. Daraufhin verschlägt es auch Peter nach Leipzig und er verliebt sich in eine junge Frau, die aus komplizierten Gründen von ihrer Großmutter Snjolaug genannt wird, von ihm dann vereinfacht Snowleg. Doch Glück ist den beiden auch nicht beschieden, die Stasi funkt dazwischen. "Angenehm unbefangen und abwechslungsreich", erzähle Shakespeare, freut sich Bartels, nichts wirke aufgesetzt oder "schwer stapfend wie oft bei den deutschen Kollegen". Und wie herrlich Shakespeare erzähle, seine Leser an der langen Leine führe, auch das Klischee nicht scheue und das große Wiedererkennen bis zum letzten Satz hinauszögere - das hält Bartels für "großen literarischen Sport und großes Kino".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH