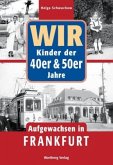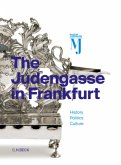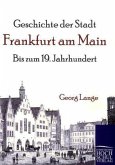Das Buch erzählt die Geschichte der "Polytechnischen" und ihrer Tochterinstitute - eingebettet in 200 Jahre Frankfurter Stadtgeschichte. Herausgegeben von der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt am Main.
"Der Begriff "Polytechnik" stammt aus der Zeit der Aufklärung und meint "viele Fertigkeiten". Die 1816 gegründete "Gesellschaft zur Beförderung der nützlichen Künste und der sie veredelnden Wissenschaften" heißt seit 1946 "Polytechnische Gesellschaft" und unterstützt die Bildungs- und Erziehungsarbeit in Frankfurt am Main. Aus dem gemeinnützigen Engagement im Zeichen des Bienenkorbs sind bedeutende Frankfurter Institutionen wie die Sparkasse von 1822 hervorgegangen. Heute wirken die Polytechniker mit der Diesterweg-Simon-Vortragsreihe und sieben Tochterinstituten in die moderne Stadtgesellschaft hinein: Stiftung für Blinde und Sehbehinderte (gegründet 1837), Wöhler-Stiftung (1846), Kunstgewerbeverein (1877), Institut für Bienenkunde (1937), Kuratorium Kulturelles Frankfurt(1957), Verein zur Pflege der Kammermusik (1959) und Stiftung Polytechnische
Gesellschaft (2005)."
"Der Begriff "Polytechnik" stammt aus der Zeit der Aufklärung und meint "viele Fertigkeiten". Die 1816 gegründete "Gesellschaft zur Beförderung der nützlichen Künste und der sie veredelnden Wissenschaften" heißt seit 1946 "Polytechnische Gesellschaft" und unterstützt die Bildungs- und Erziehungsarbeit in Frankfurt am Main. Aus dem gemeinnützigen Engagement im Zeichen des Bienenkorbs sind bedeutende Frankfurter Institutionen wie die Sparkasse von 1822 hervorgegangen. Heute wirken die Polytechniker mit der Diesterweg-Simon-Vortragsreihe und sieben Tochterinstituten in die moderne Stadtgesellschaft hinein: Stiftung für Blinde und Sehbehinderte (gegründet 1837), Wöhler-Stiftung (1846), Kunstgewerbeverein (1877), Institut für Bienenkunde (1937), Kuratorium Kulturelles Frankfurt(1957), Verein zur Pflege der Kammermusik (1959) und Stiftung Polytechnische
Gesellschaft (2005)."

Neue Einblicke in die Historie der Polytechniker
"Bürgersinn und Bürgertat" hat der Wirtschaftshistoriker Franz Lerner sein Buch über die Geschichte der Polytechnischen Gesellschaft genannt. Das Werk ist vor mehr als drei Jahrzehnten erschienen. Längst ist es an der Zeit, die Geschichte der Polytechniker fortzuschreiben und gewisse dunkle Kapitel auszuleuchten. Die Zeit des Nationalsozialismus etwa. Hierüber ist bei Lerner kaum etwas zu lesen.
Thomas Bauer hingegen, der sich unter dem Titel "In guter Gesellschaft" mit den Polytechnikern befasst hat, klammert dieses Thema nicht aus. Bauer ist freiberuflicher Historiker; er hat mehrere Werke zur Frankfurter Stadtgeschichte publiziert und einige Ausstellungen zu diesem Thema kuratiert.
Wilhelm Avieny heißt der Mann, der in braunen Zeiten die Polytechnische Gesellschaft geführt hat. Genauer: gleichgeschaltet hat. Avieny, bis zur Machtergreifung Hitlers in der Geschäftsleitung der Städte-Reklame tätig, stieg als Parteigenosse zum Generaldirektor der Nassauischen Landesbank auf und wurde Berater des Gauleiters Jakob Sprenger in Wirtschaftsfragen. Der machtbewusste und umtriebige Emporkömmling nahm jedes Amt, das er bekommen konnte. Während der zwölf Jahre der NS-Herrschaft gehörte Avieny etwa 40 Aufsichtsräten an.
Der Gauleiter erteilte ihm schon im Sommer 1936 den Auftrag, die Polytechnische Gesellschaft zu "arisieren" und auf nationalsozialistischen Kurs zu bringen. Unverzüglich stattete Avieny dem Polytechniker-Präsidenten Richard Wachsmuth einen Besuch ab und setzte den ehrenwerten Physikprofessor wegen seiner "nicht ganz arischen" Ehefrau massiv unter Druck. Einen Tag später legte Wachsmuth sein Amt nieder. Im September diktierte ein offenbar angetrunkener Gauleiter Sprenger dem Polytechniker-Vorstand eine neue Satzung. Juden durften von da an nicht mehr Mitglieder sein.
Der starke Mann war nun Sprenger. Er bestellte nach eigenem Willen einen "Vereinsführer", wie der Präsident jetzt hieß, und ersetzte die Mitglieder des engeren Führungsausschusses der Polytechnischen Gesellschaft durch überzeugte Nationalsozialisten. Sprengers verlängerter Arm war Avieny, der sich im August 1949 vor der Frankfurter Spruchkammer verantworten musste und zu dreieinhalb Jahren Arbeitslager verurteilt wurde. Der braune Spuk war damit auch für die Polytechniker zu Ende. Am 26. März 1946 nahmen die Polytechniker eine entnazifizierte Satzung an, neuer Präsident wurde Frankfurts Oberbürgermeister Kurt Blaum.
Ein anderes Thema, dem der Autor Bauer Gewicht gegeben hat, ist die Rolle der Polytechniker während der Zeit des Paulskirchen-Parlaments. Frankfurt galt den herrschenden Reaktionären schon immer als "Liberalennest". Das Metternichsche Überwachungssystem hat im November 1840 eine von einem anonymen Denunzianten verfasste Liste hinterlassen, auf der 44 Frankfurter verzeichnet sind, welche "die eigentliche liberale Partei von politischem und moralischem Einfluss dahier bilden". Siebzehn der Aufgeführten waren Polytechniker.
Allen voran der Anwalt Friedrich Siegmund Jucho, ein führender Kopf der Liberalen, der 1848 als Frankfurter Abgeordneter in die Paulskirche eingezogen ist. Über die 44 politisch Verdächtigen auf erwähnter Liste urteilen Metternichs Aufpasser, sie seien in ihren Meinungen fest begründet. Kein Wunder, da so viele Polytechniker darunter waren.
rieb.
Thomas Bauer: "In guter Gesellschaft - Die Geschichte der Polytechnischen Gesellschaft". Frankfurt 2010, Verlag Waldemar Kramer, 35 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main